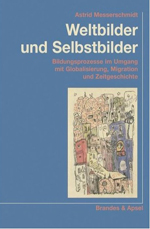 Wie können wir Bildungsprozesse ermöglichen, wenn deren Voraussetzungen und Ziele – aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben – immer uneindeutiger werden? Denn die Dynamiken, die durch veränderte ökonomische, soziale und politische Strukturen entstehen, wirken sich auf vielfältige Weise auf das Verhältnis der Generationen und damit auch auf Bildungszusammenhänge aus. Selbst unsere eigene Verstrickung in gegebene Dominanz- und Unterdrückungsverhältnisse – markiert etwa durch Geschlecht, Herkunft, Religion – wird in Zonen sogenannter Globalisierung und Migration als vielschichtig erkennbar. Dasselbe trifft auf jene zu, für die wir beabsichtigen, Bildungsprozesse anzuregen. Astrid Messerschmidts Studien zu „Bildungsprozessen im Umgang mit Globalisierung, Migration und Zeitgeschichte“ nehmen die aus diesen Kontexten erwachsenden Fragen und die darin eingelassenen Widersprüche auf. Obgleich der Wunsch nach klarer Orientierung und Reduktion der Komplexität in Anbetracht der skizzierten Herausforderungen naheliegend sein mag, positioniert sie sich in ihrem Zugang dennoch kritisch gegenüber Vereindeutigungen – selbst dann, wenn sie in kritischer Absicht vorgenommen werden. Vielmehr erachtet sie die Auseinandersetzung mit der eigenen Involvierung in die gegebenen Verhältnisse und die dieser Verschränkung immanente Widersprüchlichkeit als Anknüpfungspunkt für Bildung ebenso in praktischer Hinsicht wie in Bezug auf deren theoretische Reflexion. Messerschmidt entwickelt so ein „fragiles Konzept“ von Bildung, das es ermögliche, „Brüche und Infragestellungen“ der jeweils „eigenen durch Bildung angeeigneten Selbst- und Weltbilder zu artikulieren“ (254). Ein solches Bildungskonzept unterlaufe so zugleich die eindeutige Setzung normativer Bildungsansprüche gegenüber kritisierten gesellschaftlichen Verhältnissen. Es wird durchgängig deutlich, dass die Autorin im Zuge ihrer „Widerspruchsanalysen“ kritische Bildung ebenso wenig aufgibt wie kritische Bildungstheorie, sondern in einer (selbst-)kritischen Wendung nach neuen Wegen ihrer Ermöglichung sucht.
Wie können wir Bildungsprozesse ermöglichen, wenn deren Voraussetzungen und Ziele – aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben – immer uneindeutiger werden? Denn die Dynamiken, die durch veränderte ökonomische, soziale und politische Strukturen entstehen, wirken sich auf vielfältige Weise auf das Verhältnis der Generationen und damit auch auf Bildungszusammenhänge aus. Selbst unsere eigene Verstrickung in gegebene Dominanz- und Unterdrückungsverhältnisse – markiert etwa durch Geschlecht, Herkunft, Religion – wird in Zonen sogenannter Globalisierung und Migration als vielschichtig erkennbar. Dasselbe trifft auf jene zu, für die wir beabsichtigen, Bildungsprozesse anzuregen. Astrid Messerschmidts Studien zu „Bildungsprozessen im Umgang mit Globalisierung, Migration und Zeitgeschichte“ nehmen die aus diesen Kontexten erwachsenden Fragen und die darin eingelassenen Widersprüche auf. Obgleich der Wunsch nach klarer Orientierung und Reduktion der Komplexität in Anbetracht der skizzierten Herausforderungen naheliegend sein mag, positioniert sie sich in ihrem Zugang dennoch kritisch gegenüber Vereindeutigungen – selbst dann, wenn sie in kritischer Absicht vorgenommen werden. Vielmehr erachtet sie die Auseinandersetzung mit der eigenen Involvierung in die gegebenen Verhältnisse und die dieser Verschränkung immanente Widersprüchlichkeit als Anknüpfungspunkt für Bildung ebenso in praktischer Hinsicht wie in Bezug auf deren theoretische Reflexion. Messerschmidt entwickelt so ein „fragiles Konzept“ von Bildung, das es ermögliche, „Brüche und Infragestellungen“ der jeweils „eigenen durch Bildung angeeigneten Selbst- und Weltbilder zu artikulieren“ (254). Ein solches Bildungskonzept unterlaufe so zugleich die eindeutige Setzung normativer Bildungsansprüche gegenüber kritisierten gesellschaftlichen Verhältnissen. Es wird durchgängig deutlich, dass die Autorin im Zuge ihrer „Widerspruchsanalysen“ kritische Bildung ebenso wenig aufgibt wie kritische Bildungstheorie, sondern in einer (selbst-)kritischen Wendung nach neuen Wegen ihrer Ermöglichung sucht.
Den (bildungs-)theoretischen Bezugsrahmen für die vorgelegten Analysen bietet die Kritische Theorie Theodor W. Adornos sowie die kritische Bildungstheorie Gernot Koneffkes und Heinz-Joachim Heydorns. In diesem Sinne bezieht die Autorin den doppelten Widerspruch von „Befreiung und Herrschaft“ sowie von „Gleichheit und Herrschaft“ (8) auf Bildung als eine der Bildung inhärente Widersprüchlichkeit. Angesichts gegebener Ungleichheit kommen für Messerschmidt „die sozialen Beziehungen in Bildungsprozessen“ (8) und die Frage nach der Möglichkeit von Kritik in den Blick. Die Autorin geht dabei von einem „inneren Zusammenhang“ zwischen theoretischen wie praktischen Bildungsbemühungen und den von ihr diskutierten „gesellschaftlichen Feldern der Globalisierung, der Migration und der zeitgeschichtlichen Nachwirkungen von Nationalsozialismus und Kolonialismus“ (9) aus. Insofern gehe es um „Bildungsprozesse […], in denen keine Distanz [zu ihren Gegenständen] vorausgesetzt werden kann“ (9).
Messerschmidt plädiert dafür, Bildung nicht als Distanzierung von diesen gesellschaftlichen Feldern zu verstehen und die eigene Beteiligung für eine vermeintlich „bessere Sicht“ auszublenden, sondern gerade die eigene Involvierung und Verstrickung zu fokussieren. Das Spezifische an Bildungsprozessen in globalisierten Gesellschaftszusammenhängen, Einwanderungsgesellschaften bzw. zeitgeschichtlich situierter Gegenwart sei, dass ihre Gegenstände erst durch die jeweiligen Beziehungen zu ihnen ihre Konturen gewinnen und genau deshalb ihre eindeutige Bestimmbarkeit einbüßten. So wird Bildungsarbeit zu „einer kontextbezogenen Arbeit an den eigenen Verhältnisbestimmungen zu den gesellschaftlichen Gegenständen“ (10), womit auch Lehrenden- bzw. Lernendenpositionen nicht mehr klar abgrenzbar seien. Die Reflexion der widersprüchlichen Beziehungen und Brüche in diesen Feldern bestimmt das einleitend eingeführte Bildungsverständnis der Autorin (vgl. 16) ebenso wie in methodischer Hinsicht die in den ersten drei Kapiteln entfalteten Analysen der angesprochenen Themenfelder. Das abschließende vierte Kapitel verortet die „Suche nach einer selbstkritischen pädagogischen Theorie und Praxis“ (205-257) zusammenfassend im Kontext kritischer Bildungstheorie.
Auf eine systematische Gliederung der drei Teilkapitel verzichtet Astrid Messerschmidt. Der Aufbau der Abschnitte ist um thematische Einsatzpunkte der pädagogischen Auseinandersetzung (entwicklungspolitische oder historische Bildungsarbeit, interkulturelle Pädagogik) und von der Autorin aufgenommene „Analysekategorien“ (Fremdheit und Differenz, Postkolonialität usw.) gruppiert. Dennoch zeigt sich eine Grundstruktur in der Erarbeitung der einzelnen thematischen Bereiche. So widmet sich jedes der drei Kapitel unterschiedlichen Aspekten des Zusammenhangs zwischen dem jeweiligen gesellschaftlichen Feld und (kritischer) Pädagogik und Bildung. Messerschmidt diskutiert etwa, inwiefern Bildungsansprüche, europäisches bürgerliches Selbstverständnis und Globalisierung oder auch Beziehungen zu Fremden in zwiespältiger Weise verschränkt sind. Zudem kommen exemplarisch Formen des gesellschaftlichen und pädagogischen Umgangs mit diesen Widersprüchen zur Sprache, die Messerschmidt einer kritischen Bewertung unterzieht. An Beispielen wie dem entwicklungspolitischen Engagement von NGOs oder den Einsätzen interkultureller Pädagogik in der Einwanderungsgesellschaft werden – nicht zuletzt in dem Bemühen „das Richtige zu tun“ – Vereinnahmungsrisiken durch Vereindeutigung oder homogenisierende Identitätspolitiken analysiert. Auch in der Auseinandersetzung mit Umgangsweisen mit dem Holocaust und der deutschen Kolonialgeschichte geht es um die Infragestellung und Beunruhigung vermeintlich klar umrissener (aufgeklärter oder kritischer) Selbst- und Weltbilder und deren Bedeutung für eine kritische Bildungspraxis. Immer wieder betont Messerschmidt, dass und inwiefern gerade auch jene, die Bildungsprozesse anzuregen beabsichtigen – die Autorin mit eingeschlossen –, selbst Teil der kritisierten gesellschaftlichen Dominanz- und Unterdrückungskonstellationen sind und diese Verstrickung den „systematischen Ansatzpunkt“ (12) für Bildungstheorie und -praxis darstelle.
Wenig überraschend finden sich in diesem Buch keine Handlungsanweisungen oder didaktisierten Konzepte zur Anleitung von Bildungsprozessen. Dennoch werden in den thematischen Teilkapiteln exemplarisch Rückbezüge auf pädagogische Handlungsfelder (z.B. Filme in der Jugend- und Erwachsenenarbeit, Kriterien zur Vermittlung interkultureller Kompetenz, Umgang mit Materialen zur NS-Geschichte) angedacht und wissenschaftliche Forschungs- bzw. Theorieperspektiven angeregt. Ebenso konkretisiert sich im Verlauf der Analysen, in welcher Weise die Autorin selbstkritische pädagogische Theorie und Praxis (vgl. 205ff.) verstanden wissen will. Mit dieser Form der Kritik sei zudem ein „Anspruch … von Veränderung“ (231) verbunden, der die Möglichkeit der „Negation“ (ebd.) und der „Einmischung“ (232) miteinschließt. Wenn schließlich vor allem Widersprüche und Selbstkritik als Bezugspunkte für Bildungstheorie und -praxis im Zentrum stehen, kommt allerdings eine Diskussion der m. E. mit dem Einspruch gegenüber ungleichen gesellschaftlichen Verhältnissen aufgeworfenen Frage der Gerechtigkeit zu kurz. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage bleibt den Leserinnen und Lesern aufgegeben.
Messerschmidts Anspruch die Vielschichtigkeit der Thematiken, ihre Zusammenhänge und inneren Widersprüche zu zeigen und zugleich pädagogische Umgangsformen kritisch zu analysieren (ohne diese zu vereindeutigen) sowie ein – wenngleich fragiles – bildungstheoretisches Konzept zu formulieren, macht die Lektüre ihres Buches zu einer „Reise“, bei der das Ziel zwar keineswegs aus den Augen verloren wird, der Weg allerdings nicht geradlinig beschritten wird – und dem Verständnis der Autorin gemäß wohl auch nicht geradlinig beschritten werden kann. In diesem Sinne eigene und gesellschaftliche Verstrickungen zu reflektieren, nimmt Widersprüche ernst – eine solche Reflexion „schafft sie nicht ab“. Das gestaltet die Lektüre von Astrid Messerschmidts Buch durchwegs herausfordernd.
Astrid Messerschmidt ist bemüht die theoretischen Bezüge – insbesondere zur kritischen Bildungstheorie, zu postkolonialen Theorieeinsätzen und antirassistischer Pädagogik – erläuternd darzustellen. Gleichwohl dürfte eine vorausgehende erste Orientierung hinsichtlich dieser (bildungs-)theoretischen Zugänge für Studierende bzw. pädagogisch Interessierte hilfreich sein. Insofern könnten Studierende eine Reihe von Anknüpfungspunkten finden, ihre bisherige Auseinandersetzung zu erweitern und eigene Bildungserfahrungen zu reflektieren. Die Anregung, sich mit eigenen (Bildungs-) Ansprüchen in Beziehung zu gesellschaftlichen (Ungleichheits-) Verhältnissen auseinanderzusetzen, sowie unsere Verstrickung in diese Verhältnisse als Lehrende und Lernende in der Theoriebildung aufzunehmen, kann darüber hinaus meines Erachtens allen empfohlen werden, die in Bildungsinstitutionen tätig sind und/oder zu bildungstheoretischen Themen arbeiten. Denn Messerschmidts Analysen machen deutlich, dass sich die Relevanz der Frage nach Bildungsprozessen im Umgang mit Globalisierung, Migration und Zeitgeschichte keineswegs auf „teilpädagogische“ Anliegen beschränkt.
