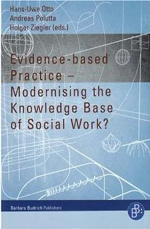 Wer in der rapide ansteigenden Zahl kontroverser Publikationen zu Evidence-Based Practice (EBP) in der Sozialen Arbeit Orientierung sucht, ist mit dieser Sammlung von 14 Aufsätzen (in englischer Sprache) gut bedient. Dominiert von Autoren/innen aus dem anglo-amerikanischen Raum, in dem der EBP Diskurs schon länger das Feld medizinischer und sozialer Praxis bestimmt, beleuchtet das Buch exemplarisch einige der zentralen Argumentationslinien im aktuellen Diskurs um EBP.
Wer in der rapide ansteigenden Zahl kontroverser Publikationen zu Evidence-Based Practice (EBP) in der Sozialen Arbeit Orientierung sucht, ist mit dieser Sammlung von 14 Aufsätzen (in englischer Sprache) gut bedient. Dominiert von Autoren/innen aus dem anglo-amerikanischen Raum, in dem der EBP Diskurs schon länger das Feld medizinischer und sozialer Praxis bestimmt, beleuchtet das Buch exemplarisch einige der zentralen Argumentationslinien im aktuellen Diskurs um EBP.
Dabei fokussieren einige Beiträge ein Verständnis von EBP als „Verb“, also als Einzelfallpraxis, nach der Praktiker/innen in jedem Fall die beste vorhandene empirische Wirkungsforschung verbinden sollen mit ihrem professionellem Wissen sowie dem Willen und Wünschen der jeweiligen Klient/innen. Andere widmen sich eher der Idee von EBP als „Nomen“, also dem Versuch auf politisch-organisatorischer Ebene, gemäß den Ergebnissen quantitativer Wirkungsforschung Praxis zu steuern, z. B. durch die Beschränkung auf standardisierte Verfahren oder vordefinierte Programme.
Es kommen sowohl Befürworter/innen wie Gegner/innen zur Sprache, wenn auch die kritischen Stimmen deutlich überwiegen. Schon das wohlplatzierte Fragezeichen am Ende des Titels deutet auf die eher skeptische Grundhaltung gegenüber den Ansprüchen hin, die EBP für sich erhebt. Keine/r der hier schreibenden Skeptiker/innen bestreitet den Wert von Wirkungsstudien oder die Idee, dass das Wissen um die Ergebnisse solcher Forschungen einen Platz im Wissensbestand für die Praxis Sozialer Arbeit hat. Indem sie Forschungsbeweise als wesentliche Wissens- und Entscheidungsgrundlage nutzt, sei EBP insgesamt professioneller, ethischer, transparenter, demokratischer als andere traditionelle Praxen Sozialer Arbeit. Ob diese Form des Wissens aber „besser“ ist als andere und einer Hierarchie gefolgt werden soll, in der quantitative Effektivitätsstudien ganz oben und andere Formen und Quellen des Wissens weiter unten angesiedelt sind, ist Bestandteil der Auseinandersetzungen um EBP. Ebenso wird die Frage diskutiert, ob Logik und Ethik eines solchen technisch-rationalen Ansatzes der Profession Sozialer Arbeit überhaupt zuträglich sind.
Die Herausgeber haben die Beiträge zu drei Schwerpunkten gruppiert und führen jeden Teil mit einem prägnanten Aufriss der zentralen Fragen ein. Der erste Teil befasst sich schwerpunktmäßig mit epistemischen Fragen nach „Wissen“ in Sozialer Arbeit. Am Beispiel einer Forschungsinitiative zu „Adult Care“ in Großbritannien problematisiert z. B. Janet Newman, wessen Wissen in EBP zählt und welche Formen von Beweisen Geltungskraft zugeschrieben wird. Für Newman sind Professionelle und Klienten interpretierende Akteure, die immer in lokalen Kontexten aus Vorgaben Sinn zu machen suchen. Politische Steuerung auf Basis von rational quantitativen Evidenzen allein blendet diese interpretativen Aushandlungsprozesse ebenso aus wie die Innovationen, die aus lokalen Reinterpretationen und Regelbrüchen resultieren.
Ähnlich argumentiert Malcolm Payne, in der Tradition von Donald Schöns „Reflective Practitioner“, für Sozialarbeiter/innen, die als „weise Menschen” zwischen technischem Können, formalem Wissen und den situativen Kontingenzen klug improvisieren können. Für Payne ist das Modell EBP durch seine Rigidität keine gute Basis für solch weise Praxis.
Der zweite Teil der Sammlung fokussiert forschungsmethodologische Fragen darüber, ob und wie Evidenz denn gemessen und implementiert werden kann. EBP-Befürworter Soydan, Pignotti und Thyer kommen hier zu Wort und plädieren für randomisierte Kontrollgruppenstudien, die für eine „interventionistische” Profession wie die Soziale Arbeit nicht nur möglich und geeignet, sondern notwendig seien. Im Rahmen der Annahmen quantitativer Wirkungsforschung sind diese Argumente überzeugend, und Haluk Soydans Erläuterungen zu Konzepten der „Validität“ von Forschung sind überdies nützlich für Leser/innen, die mit diesen Begriffen nicht täglich umgehen.
Gleichzeitig sind Soydans Ausführungen eine Steilvorlage für Martyn Hammersley, der im darauf folgenden Kapitel genau jene Annahmen problematisiert, die Soydan auslässt. Zum einen verschweigt die Behauptung, EBP sei mehr transparent als andere Praxen, dass EBP de facto nur für privilegierte Forschungsgebildete wirklich „transparent“ ist und eben kaum für die meisten Praktiker/innen Sozialer Arbeit. Zum anderen ist Forschungsevidenz nicht wertneutral, sondern immer „für“ oder „gegen“ ein ganz bestimmtes Vorgehen ausgerichtet und setzt Wertentscheidungen über „gut“ und „schlecht“ bereits voraus. Hier wird die Problematik des Imports von EBP aus dem medizinischen ins soziale Feld besonders deutlich, denn es besteht in den wenigsten Arbeitsfeldern Sozialer Arbeit Eindeutigkeit darüber, welche Ziele und Wege grundsätzlich „gut/besser“ oder „schlecht/er“ sind.
Im dritten Teil des Buches steht die professionstheoretische Frage nach Integration des EBP-Diskurses in das Selbstverständnis von Praxis und Identität Sozialer Arbeit im Mittelpunkt. So erklärt Stephen Webbs passionierter Beitrag die Popularität und Logik von EBP im Kontext neo-liberaler „Risiko Management“-Regime, die nicht nach dem politisch-ökonomischen Warum sozialer Problemlagen suchen, sondern aufgrund statistischer Wahrscheinlichkeiten besondere „Gefährdungen“ klassifizieren, vorhersagen und durch regulierte Praktiken abwenden wollen. Die Identität Sozialer Arbeit als Profession für mehr soziale Gerechtigkeit tritt, gehüllt in den Mantel technisch-rationaler Expertise, zurück hinter ein Selbstverständnis, das vorrangig damit beschäftigt ist, vermeintlich objektive Instrumentarien für Assessments, standardisierte Manuale für Behandlungen etc. umzusetzen.
EBP, so scheint es, „modernisiert“ in der Tat das Wissen Sozialer Arbeit. Das Modell bringt die Wissensproduktion in die wissenschaftliche Moderne, einer Moderne, in der empirisch-kausale, statistische Daten als beste und beweisbare Fakten gelten, um sich „Wahrheiten“ anzunähern. Doch das epistemische und professionelle Selbstverständnis Sozialer Arbeit ist inzwischen vielfach post-modern und konstruktivistisch, wie der fröhlich irritierende Beitrag von Wastell und White zum Wert kritisch-kreativer Unwissenheit besonders verdeutlicht.
Hier treffen zwei Geisteshaltungen aufeinander, die nicht wirklich integrierbar, sondern allenfalls komplementär kombinierbar sind. Entsprechend schlagen die Herausgeber im letzten Kapitel vor, das bestehende Konzept von EBP um hermeneutische Ideen zu erweitern. Wissen in einer solchen zweiten Generation von EBP ist nicht beschränkt auf die Erklärung dessen, was funktioniert, sondern meint auch das reflektive Verstehen von wie, wann und warum.
Insgesamt gelingt den Herausgebern ein Schnappschuss aktueller Diskurslinien zu einem Thema, das lange nicht an Aktualität verlieren dürfte. In einigen wenigen Beiträgen fehlt eine klar artikulierte Verbindung zum Diskurs von EBP, was ihren Wert insgesamt nicht schmälert, aber Leser/innen z.B. vor die Aufgabe stellt, die Einordnung selbst zu erarbeiten. Diese Anforderungen und der relativ akademische Ton der Beiträge machen das Buch überwiegend für Leser/innen geeignet, die zumindest etwas Vorwissen zum Thema EBP mitbringen.
