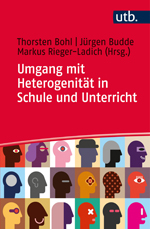 Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass 2017 eine Publikation zum âUmgang mit HeterogenitĂ€t in Schule und Unterrichtâ vorgelegt wird, nachdem in den letzten Jahren eine unĂŒberschaubar gewordene Anzahl von EinzelbeitrĂ€gen, HerausgeberbĂ€nden, EinfĂŒhrungen und auch LehrbĂŒchern erschienen sind, die sich dem erziehungswissenschaftlichen Problematisierungsanlass âHeterogenitĂ€tâ widmen. Nicht zuletzt ist der pĂ€dagogische Topos âUmgang mit HeterogenitĂ€tâ mittlerweile selbst zum Gegenstand (erkenntnis-)kritischer Reflexionen gemacht geworden, woraus spezifische diskursive PrĂ€missen fĂŒr die theoretische und empirische Auseinandersetzung mit dem Thema HeterogenitĂ€t in schulischen Handlungskontexten resultieren. Vor diesem Hintergrund konfrontiert sich das von Thorsten Bohl, JĂŒrgen Budde und Markus Rieger-Ladich herausgegebene Studienbuch mit einer anspruchsvollen Herausforderung, soll das formulierte Ziel, âden âstate of the artâ der Forschungâ abzubilden und die einschlĂ€gige erziehungswissenschaftliche nationale wie internationale Diskussion in systematischer Weise zugĂ€nglich zu machen (8), eingelöst werden.
Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass 2017 eine Publikation zum âUmgang mit HeterogenitĂ€t in Schule und Unterrichtâ vorgelegt wird, nachdem in den letzten Jahren eine unĂŒberschaubar gewordene Anzahl von EinzelbeitrĂ€gen, HerausgeberbĂ€nden, EinfĂŒhrungen und auch LehrbĂŒchern erschienen sind, die sich dem erziehungswissenschaftlichen Problematisierungsanlass âHeterogenitĂ€tâ widmen. Nicht zuletzt ist der pĂ€dagogische Topos âUmgang mit HeterogenitĂ€tâ mittlerweile selbst zum Gegenstand (erkenntnis-)kritischer Reflexionen gemacht geworden, woraus spezifische diskursive PrĂ€missen fĂŒr die theoretische und empirische Auseinandersetzung mit dem Thema HeterogenitĂ€t in schulischen Handlungskontexten resultieren. Vor diesem Hintergrund konfrontiert sich das von Thorsten Bohl, JĂŒrgen Budde und Markus Rieger-Ladich herausgegebene Studienbuch mit einer anspruchsvollen Herausforderung, soll das formulierte Ziel, âden âstate of the artâ der Forschungâ abzubilden und die einschlĂ€gige erziehungswissenschaftliche nationale wie internationale Diskussion in systematischer Weise zugĂ€nglich zu machen (8), eingelöst werden.
Das Studienbuch gliedert sich in vier ĂŒbergeordnete Kapitel: Kapitel I âTheoretische Grundlinienâ wird mit einem Beitrag von JĂŒrgen Budde eröffnet, der sich dem Gegenstandsbereich in systematisierender Absicht annĂ€hert, wobei die âUnbestimmtheitâ des Begriffs HeterogenitĂ€t ein zentrales Motiv sowohl fĂŒr den Problemaufriss als auch fĂŒr das abschlieĂende Fazit darstellt. In kritischer Distanz zum Postulat einer gegebenen Unterschiedlichkeit von SchĂŒler*innen, auf die die Institution Schule lediglich reagiert, werden die mit dem Konzept HeterogenitĂ€t aufgerufenen Differenzkonstruktionen als aktive Herstellungsleistung im Kontext von Schule und Unterricht thematisiert. Zudem wird der Versuch unternommen, Abgrenzungen gegenĂŒber âverwandten Begriffenâ (21) wie DiversitĂ€t, IntersektionalitĂ€t und Inklusion vorzunehmen. WĂ€hrend Budde konstatiert, dass âHeterogenitĂ€tskonstruktionen im schulischen Feld von MachtverhĂ€ltnissen durchzogen sindâ (21), geht der anschlieĂende Beitrag von Markus Rieger-Ladich davon aus, dass dies auch fĂŒr den erziehungswissenschaftlichen Diskurs und âdie pĂ€dagogische Rede von HeterogenitĂ€tâ (27) selbst gilt. Mit Fokus auf die ordnungsstiftende Bezeichnungs- und Klassifizierungspraxis, die etwas ĂŒberhaupt erst als different bzw. abweichend in Erscheinung treten lĂ€sst, wird die dem HeterogenitĂ€tsdiskurs eignende âOntologieâ der Verschiedenheit problematisiert und die Perspektive auf die Folgen machtvoller Differenzmarkierungen und die AusschlieĂung produzierenden NormalitĂ€tserwartungen von Bildungsinstitutionen umgestellt. Dass das Problem der âMachtförmigkeitâ (43) nicht nur die sozialen Unterscheidungen, mit denen Individuen bezeichnet werden, betrifft, sondern auch fĂŒr den mit den Konzepten von âChancengleichheitâ und âAnerkennungâ entfalteten normativen BegrĂŒndungszusammenhang heterogenitĂ€tssensibler AnsĂ€tze folgenreich ist, bildet den analytischen Ausgangspunkt des Beitrags von Paul Mecheril und Andrea J. Vorrink.
Die in Kapitel II âHeterogenitĂ€tskategorien und -felderâ folgenden BeitrĂ€ge von Frank-Olaf Radtke (âKulturâ), Christine Thon (âGeschlechtâ) und Albert Scherr (âKlasseâ) entfalten ihre Diskussion der in Rede stehenden Kategorien/Konzepte auf der Grundlage unterschiedlicher Bezugnahmen auf gesellschaftstheoretisch informierte Ăberlegungen. WĂ€hrend Radtke die TragfĂ€higkeit von âKulturâ als Analysekategorie im Migrationskontext grundlegend in Frage stellt, erweisen sich âGeschlechtâ und âKlasseâ Thon und Scherr folgend als unverzichtbarer Bezugspunkt eines analytischen Zugriffs auf soziale UngleichheitsverhĂ€ltnisse und bildungsinstitutionelle Strukturbildungen. Eine von allen bislang genannten BeitrĂ€gen geteilte Problematisierungsachse bildet dabei die pĂ€dagogisch motivierte Zuschreibung von Gruppenzugehörigkeiten, die bei Radtke ihren Ausdruck in einer grundlegenden Skepsis gegenĂŒber der Adressierung von Individuen als âReprĂ€sentanten von Kollektivenâ (74) und ihrer identitĂ€tspolitischen Aufladung im pĂ€dagogischen Kontext findet. Mit den BeitrĂ€gen von Dieter Katzenbach sowie Katharina Walgenbach und Lisa Pfahl wird neben grundlegenden konzeptionellen Ăberlegungen zu âInklusionâ und âIntersektionalitĂ€tâ ein stĂ€rkerer Fokus auf die bildungsinstitutionellen Exklusionsprozesse gelegt, die sich mit der Zuschreibung des Merkmals âBehinderungâ resp. eines sonderpĂ€dagogischen Förderbedarfs verbinden und die nicht zuletzt auf eine latente soziale Differenzierungspraxis hinweisen. Der diesem Teilkapitel auch zugeordnete Beitrag von Jasmin Decristan und Nina Jude liegt hinsichtlich der darin thematisierten âHeterogenitĂ€tskategorie Schulleistungâ gewissermaĂen âquerâ zu den anderen BeitrĂ€gen, insofern hier zum einen ein nicht sozial zugeschriebenes, sondern ein als individuell erworben verstandenes Merkmal im Vordergrund steht, zum anderen auf die theoretisch-konzeptionelle ErschlieĂung der Kategorie Schulleistung verzichtet wird. Die der Diskussion zu Erscheinungsformen und Ursachen von Leistungsunterschieden zugrunde gelegten einschlĂ€gigen empirischen Befunde geben gleichwohl Hinweise darauf, dass es sich auch im Fall von Schulleistung um ein Merkmal handelt, das seinerseits von sozialen Zuschreibungspraxen nicht unbeeinflusst ist.
Der das Kapitel III âSchulsystem und Einzelschuleâ eröffnende Beitrag von Merle Hummrich geht der Bedeutung einer international-vergleichenden Perspektive nach und weist dabei am Beispiel von Deutschland und USA auf die jeweiligen kulturell-historischen Tradierungen und schulstrukturellen Besonderheiten im âUmgang mit HeterogenitĂ€tâ. Der anschlieĂende Beitrag von Isabell van Ackeren und Svenja Mareike KĂŒhn verdeutlicht, wie eng die historisch variierenden Differenzierungsmuster zur Herstellung (vermeintlich) homogener Lerngruppen (entlang von Stand, Schicht, Geschlecht oder âBegabungâ) an die in ihren GrundzĂŒgen bis heute unverĂ€ndert verbliebene hierarchisch gegliederte Struktur des deutschen Bildungswesens rĂŒckgebunden sind. Der Beitrag von Albrecht Wacker zu Schulstruktur und Zweigliedrigkeit akzentuiert demgegenĂŒber nicht das institutionelle Beharrungsvermögen des Bildungssystems, sondern fokussiert den aktuellen Wandel zu unterschiedlichen Varianten der Unterscheidung von gymnasialen und nicht-gymnasialen Schulformen und diskutiert auf der Basis der bislang nur unzureichend vorliegenden empirischen Befunde mögliche Effekte dieses Wandels auf das AusmaĂ und die Erscheinungsformen sozialer DisparitĂ€ten. Im abschlieĂenden Beitrag dieses Kapitels stellen Barbara Wimmer und Herbert Altrichter Bedingungen und Möglichkeiten heterogenitĂ€tsorientierter Schulentwicklungsstrategien vor.
Das Kapitel IV âProfessionalisierung, Unterricht, Didaktikâ wird von einem Beitrag von Ina Biederbeck und Martin Rothland eröffnet, der den âUmgang mit HeterogenitĂ€tâ als Bezugspunkt fĂŒr Professionalisierungsprozesse zum einen auf der Grundlage unterschiedlicher professionstheoretischer AnsĂ€tze, zum anderen auf der Grundlage empirischer Befunde aus dem Kontext der Einstellungs- und Selbstwirksamkeitsforschung diskutiert. WĂ€hrend dabei âHeterogenitĂ€tâ als âempirischerâ Sachverhalt und im Sinne eines gegebenen professionellen Handlungsproblems vorausgesetzt wird, betont der aus der Perspektive der empirischen Lehr-Lernforschung und pĂ€dagogischen Diagnostik geschriebene Beitrag von Karl-Heinz Arnold und Carola Lindner-MĂŒller erneut die âUnterbestimmtheitâ (238) des HeterogenitĂ€tskonstruktes. Im Rahmen der Diskussion von Formen und (Neben-)folgen adaptiver Unterrichtsstrategien steht das ĂŒbergeordnete schulpĂ€dagogische Thema der Lerngruppendifferenzierung im Fokus, welches in den anschlieĂenden BeitrĂ€gen von Thorsten Bohl, Thomas HĂ€cker sowie Susanne Prediger und Claudia von Aufschnaiter ausfĂŒhrlicher behandelt wird. Die in der programmatisch orientierten HeterogenitĂ€tsliteratur hĂ€ufig generalisierend als âProblemlösungsstrategienâ angebotenen didaktisch-methodischen Ăberlegungen zum individualisierten oder adaptiven Unterricht werden von Bohl in RĂŒckbindung an allgemeine empirische Befunde zu UnterrichtsqualitĂ€t einer differenzierenden Betrachtung unterzogen, wĂ€hrend Prediger und von Aufschnaiter aus fachdidaktischer Perspektive Gelingensbedingungen eines niveaudifferenzierenden Lernens diskutieren. HĂ€cker konfrontiert die programmatische Orientierung an âIndividualisierungâ mit empirischen Befunden aus quantitativen und qualitativ-rekonstruktiven Studien und verdeutlicht, dass individualisierender Unterricht mit Blick auf die Problemstellung der (Re-)produktion von Bildungsungleichheit nicht ohne weiteres als Teil der Lösung, sondern ebenso auch als ein möglicher Teil des Problems reflexiv in Rechnung gestellt werden muss.
In der Gesamtbetrachtung der lesenswerten und anspruchsvollen BeitrĂ€ge des Studienbuches zeigt sich eine breite und die mittlerweile erreichte disziplinĂ€re Ausdifferenzierung dokumentierende Bearbeitung der Thematik. Der Band reprĂ€sentiert aber auch insofern den âstate of the artâ â zumindest der deutschsprachigen Forschung â, als die differenzierte Entfaltung der unterschiedlichen fachspezifischen bzw. subdisziplinĂ€ren Zugangsweisen verdeutlicht, dass von einer einheitlichen theoretischen Fassung des pĂ€dagogischen Sachverhaltes âHeterogenitĂ€tâ nicht ausgegangen werden kann, sondern dass es sich, wie von den Herausgebern in der Einleitung markiert, um durchaus âwiderstreitende Perspektivenâ (12) handelt. Damit verweisen die BeitrĂ€ge in ihrer Summe auch auf ein grundlegendes Dilemma des erziehungswissenschaftlichen Diskurs- und Forschungsfeldes âHeterogenitĂ€tâ: WĂ€hrend âHeterogenitĂ€tâ im RĂŒckgriff auf sozialkonstruktivistische Theorieangebote zum Gegenstand einer ungleichheits- und machtanalytischen Reflexion gemacht und auch als Effekt institutioneller Beobachtungsweisen thematisiert wird, scheinen sowohl die empirische Beobachtung von HeterogenitĂ€t in Schule und Unterricht als auch didaktische Differenzierungskonzepte aus methodologischen GrĂŒnden nicht auf jene âontologischeâ Annahme der als solches gegebenen ungleichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen verzichten zu können. Hinsichtlich der systematischen Analyse des Zusammenhangs von HeterogenitĂ€t und Ungleichheit im Bildungssystem artikuliert sich in dem Band damit nolens volens ein nach wie vor bestehendes Desiderat: Gerade weil von einer komplexen VerschrĂ€nkung leistungsdifferenzierender und intersektionaler Zuschreibungslogiken in Schule und Unterricht auszugehen ist, wirft der in Rede stehende Gegenstandsbereich auch grundlegende methodologische Fragen auf, die in der erziehungswissenschaftlichen Fachdiskussion gegenwĂ€rtig erst in AnsĂ€tzen bearbeitet werden [1]).
[1] Diehm, Isabell/Kuhn, Melanie/Machold, Claudia (Hrg.): Differenz â Ungleichheit â Erziehungswissenschaft. VerhĂ€ltnisbestimmungen im (Inter-)DisziplinĂ€ren. Wiesbaden: Springer VS 2017.
