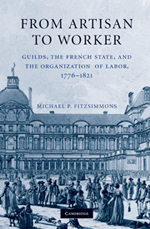 Mit „From artisan to worker“ legt der amerikanische Historiker Michael P. Fitzsimmons eine auf umfangreicher Archivforschung basierende Studie zu einer bislang vernachlässigten Fragestellung vor. Im Zentrum der Arbeit steht die Zunftpolitik im Frankreich der Jahre 1776-1821, also in einer zumindest in der ideen- und politikgeschichtlichen Forschung prominenten Phase. Publikationen, die sich mit der Geschichte der Zünfte und der Organisation von Arbeit im Zeitalter der Industrialisierung befassen, reichen mit Bezug auf Frankreich jedoch entweder nicht über 1791, den Zeitpunkt, als die Zünfte formell abgeschafft wurden, hinaus, oder dann setzen sie erst mit der Restauration, als sich eine ,Arbeiterklasse’ im Zuge forcierter Mechanisierung und Massenproduktion zu formieren begann, ein. Die Arbeit von Fitzsimmons schliesst nicht nur diese Lücke. Es gelingt ihm ausserdem zu zeigen, wie bedeutsam solche mit Bezug auf den Untersuchungsgegenstand wenig ereignishaft erscheinenden Phasen für das Verständnis historischer Prozesse, hier des Übergangs von der zünftisch-handwerklichen Ordnung ins industrielle Zeitalter, sein können. So ist der irreversible Übertritt Frankreichs im 19. Jahrhundert auf den „path of industrialisation“ (6) nicht verständlich ohne Kenntnis dieser Phase mit prinzipiell offenem Ausgang. Denn obwohl nach 1791 das Zunftwesen nie mehr auf gesetzlichem Weg eingeführt wurde, folgten zahlreiche Vorstösse zur Wiedereinsetzung zünftischer oder Zunft ähnlicher Korporationen. Das heisst, über drei Jahrzehnte hinweg wurden die Vor- und Nachteile des feudal-hierarchischen und des liberalen Wirtschaftsordnungen immer wieder von Neuem gegeneinander abgewogen, ohne dass sich ein Entscheid zugunsten der einen oder anderen klar aufgedrängt hätte.
Mit „From artisan to worker“ legt der amerikanische Historiker Michael P. Fitzsimmons eine auf umfangreicher Archivforschung basierende Studie zu einer bislang vernachlässigten Fragestellung vor. Im Zentrum der Arbeit steht die Zunftpolitik im Frankreich der Jahre 1776-1821, also in einer zumindest in der ideen- und politikgeschichtlichen Forschung prominenten Phase. Publikationen, die sich mit der Geschichte der Zünfte und der Organisation von Arbeit im Zeitalter der Industrialisierung befassen, reichen mit Bezug auf Frankreich jedoch entweder nicht über 1791, den Zeitpunkt, als die Zünfte formell abgeschafft wurden, hinaus, oder dann setzen sie erst mit der Restauration, als sich eine ,Arbeiterklasse’ im Zuge forcierter Mechanisierung und Massenproduktion zu formieren begann, ein. Die Arbeit von Fitzsimmons schliesst nicht nur diese Lücke. Es gelingt ihm ausserdem zu zeigen, wie bedeutsam solche mit Bezug auf den Untersuchungsgegenstand wenig ereignishaft erscheinenden Phasen für das Verständnis historischer Prozesse, hier des Übergangs von der zünftisch-handwerklichen Ordnung ins industrielle Zeitalter, sein können. So ist der irreversible Übertritt Frankreichs im 19. Jahrhundert auf den „path of industrialisation“ (6) nicht verständlich ohne Kenntnis dieser Phase mit prinzipiell offenem Ausgang. Denn obwohl nach 1791 das Zunftwesen nie mehr auf gesetzlichem Weg eingeführt wurde, folgten zahlreiche Vorstösse zur Wiedereinsetzung zünftischer oder Zunft ähnlicher Korporationen. Das heisst, über drei Jahrzehnte hinweg wurden die Vor- und Nachteile des feudal-hierarchischen und des liberalen Wirtschaftsordnungen immer wieder von Neuem gegeneinander abgewogen, ohne dass sich ein Entscheid zugunsten der einen oder anderen klar aufgedrängt hätte.
Aus der Perspektive der vergleichenden Berufsbildungsforschung gehört Frankreich zu den herausragenden Beispielen, die, im Gegensatz etwa zu Deutschland oder der Schweiz, ein vollzeitschulisches Berufsbildungswesen entwickelt haben. Der Entscheid für oder gegen die duale Berufsbildung mit seiner Tradition in der vormodernen Meisterlehre fiel im Laufe des 19. Jahrhunderts im Kontext der Auseinandersetzung mit liberalen wirtschafts- und staatspolitischen Ideen. Die Studie von Fitzsimmons gibt einen detaillierten Einblick in die politischen Diskussionen und Ereignisse, aus denen dieser Entscheid in Frankreich schon sehr früh hervorgegangen ist. Denn mit den Zünften wurde neben dem Meistertitel auch die Berufslehre beseitigt. Angesichts sinkender Qualitätsstandards bei der Güterproduktion, aber auch von Disziplin- und Ordnungsproblemen am Arbeitsplatz kam im Kontext der Zunftfrage auch das Thema der beruflichen Ausbildung immer wieder auf.
Fitzsimmons gliedert die in seinem Buch untersuchte Zeitspanne in vier Phasen: Erste Marksteine bilden die Zunft-Verbote von 1776 unter Turgot und 1791 durch die Assemblée Nationale; die zweite Phase umfasst die Gewerbepolitik der Revolutionszeit bis zum Ende des Direktoriums (1799); die dritte Phase markiert das Wiederauftreten von Zünften und Korporationen während des Konsulats (1800-1811); schliesslich die Ära der Restauration, die erstaunlicherweise das definitive Verschwinden der Zünfte herbeiführte.
Beachtet man die weit ausgreifenden Funktionen, die den ‚corporations’ bzw. ‚corps de métier’ im städtischen wirtschaftlichen und sozialen Leben des 18. Jahrhunderts zukamen, ist deren Auflösung 1776 aufgrund eines Reformprogrammes des französischen Finanzministers Anne-Robert-Jacques Turgot unter Louis XVI. überraschend. Dies geschah unter Anführung zweier Argumente, die auch in den kommenden 50 Jahren Gültigkeit behalten sollten: Privilegien sollten abgeschafft und Hindernisse für die Entwicklung der Industrie – als solche wurden die zünftischen Strukturen wahrgenommen – beseitigt werden. Nach kurzer Zeit wurde das Verdikt wieder aufgehoben, die erneuerten Korporationen erlangten in der Folge allerdings nicht mehr ihre frühere Stärke und Kohäsion.
Nach Ausbruch der Revolution erfolgte der Entscheid der Assemblée Nationale zum Verbot der Zünfte nur zögerlich. Gründe hierfür waren die Furcht vor Aufständen während einer ohnehin turbulenten Zeit sowie der Verlust von für die Städte bedeutsamen Steuern. Die finanziellen Einbussen sollten zumindest in Teilen mit den im selben Jahr, 1791, eingeführten ‚patentes’ ausgeglichen werden. Es handelte sich dabei um jährlich zu erneuernde Lizenzen zur selbstständigen Ausübung von Handel und Gewerbe, die kostenpflichtig waren. Der Radikale Jean-Paul Marat gehörte zu den prominenten Kritikern dieser Einrichtung, da die Vergabe von Patenten an keine Fähigkeitsprüfung geknüpft war und auch keine Berufslehre voraussetzte. Seine Befürchtungen, dass dies mit einem Absinken der Qualitätsstandards einhergehen und zum Ruin des Handels führen würde, sollten sich in Bezug auf verschiedene Güter bewahrheiten.
Die Abschaffung der Zünfte per Gesetz von 1791 hinterliess ein Vakuum bezüglich Aufsicht und Kontrolle der Qualität der Waren mit täglich spürbaren Folgen. Vor allem in Paris folgten auf die Deregulierung Versorgungsnotstände, die manche Menschen die vergangenen Zustände herbeisehnen liessen. Dies galt besonders in Zeiten von Krieg und Rezession. Die Qualitätsproblematik sollte zum schlagenden Argument für die Wiedereinführung der Zünfte werden. Durchgehendes Argument auf Seiten der Zunft-Gegner war hingegen die Überzeugung, dass die zünftischen Strukturen jeglicher Innovation feindlich entgegenstanden und so ein Aufholen gegenüber dem technischen Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg in erster Linie Grossbritanniens verhinderten. Das Potential standardisierter und z.T. maschineller Massenproduktion wurde besonders angesichts der Erfordernisse der Kriegsproduktion bei gleichzeitiger Massenkonskription in der ersten Hälfte der 90er Jahre deutlich.
Gemäss Fitzsimmons lässt sich unter Napoleon keine kohärente Gewerbepolitik ausmachen, eher scheinen Entscheide im diskursiven Umfeld der Zunftfrage von Fall zu Fall zustande gekommen zu sein. Politisch weniger ideologisch als das revolutionäre Regime veranschlagte er den Wert von Ordnung und Disziplin auch in gewerbepolitischen Belangen über dem Prinzip der Freiheit. Dies führte dazu, dass sich zuerst die Bäcker und Metzger von Paris, später auch andere Berufe in weiteren Städten zu Zünften und Zunft ähnlichen Korporationen zusammenschliessen konnten. Mit wenigen Ausnahmen geschah dies eigenmächtig und an der Gesetzgebung vorbei, entweder durch die ordnungspolitische Instanz des Pariser Polizeipräfekten oder auf Veranlassung kommunaler Behörden. Liessen sich mit Bezug auf die Bäcker und insbesondere die Pariser Metzger sanitäre Gründe bzw. die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung anführen, so verlor diese Begründung im Laufe der Zeit an Relevanz. In die Zeit der napoleonischen Herrschaft fällt mit dem Gesetz vom 12. April 1803 die grösste Intervention im Bereich von Gewerbe und Arbeit seit Abschaffung der Zünfte im Jahre 1791, das auch die Berufslehre wieder regelte. Allerdings wurde die Lehre nicht zur Bedingung für die Ausübung eines Gewerbes. Spätere Vorstösse in Richtung der obligatorischen Berufslehre blieben chancenlos, so dass diese zur Zeit der Restauration eigentlich nicht mehr existierte.
In jener Zeit war der Zentralregierung die Kontrolle über die Gründung von Korporationen entglitten. Die Bourbonen-Monarchie setzte vorerst den gewerbepolitischen Kurs des Empire fort. Ein deutliches Signal zu Gunsten technischer Innovation und industriellen Fortschritts – und das heisst in der damals in Frankreich vorherrschenden Semantik gleichzeitig zu Ungunsten der Wiedereinführung zünftischer Regulationen – setzte aber die pompös inszenierte, nach Jahren unter neuem politischen Vorzeichen erstmals wieder durchgeführte nationale Gewerbeausstellung von 1819, die durch die ausgedehnte und mehrmalige Anwesenheit des Königs glänzte. Den ab 1798 durchgeführten Gewerbeausstellungen kam eine wichtige Funktion zu, wenn es darum ging, das Paradigma der Handels- und Gewerbefreiheit gegenüber der Wiedereinführung zünftischer Privilegien zu verteidigen. Zuerst veranstaltet im Rahmen der Jahresfeier der Gründung der Republik waren diese dazu geeignet, technische Errungenschaften und den industriellen Fortschritt in ein positives Licht zu rücken.
„From artisan to worker“ zeigt eine eindrückliche Kontinuität sich ähnelnder Argumente, die über die sich ablösenden Regimes hinweg für und wider zünftische Regulationen und Privilegien vorgebracht wurden. Diese Tatsache zusammen mit der vom Autor angewendeten Akribie nicht nur in der Quellenanalyse, sondern auch in der Ergebnisdarstellung führt zu Redundanzen und einer gewissen Langatmigkeit, sie verstellt dem Leser bzw. der Leserin zuweilen den Blick auf die grösseren Zusammenhänge und Entwicklungslinien.
Fitzsimmons nähert sich seinem Gegenstand zwar nicht aus bildungshistorischer Perspektive, dennoch ist das Buch instruktiv für die an der Geschichte der Berufsbildung interessierte Leserschaft. Mit Bezug auf die Berufsbildungsgeschichte verweist es einerseits auf die generelle Bedeutung nationenspezifischer Entwicklungen im Bereich von Politik und Wirtschaft, die auf den Übergang zum modernen Staat und zur industriellen Produktion zurückgehen. Mit Frankreich führt die Studie zudem einen vom Verlauf in Deutschland oder der Schweiz deutlich differenten Fall vor Augen und gibt auch gleich Hinweise auf wichtige Ursprünge der Formierung der französischen Berufsbildung in ihrer Spezifik. Im Gegensatz zu anderen Ländern existierte im (nach-)revolutionären Frankreich eine Reminiszenz, die jegliche Qualitätskontrolle und Vorschriften, so auch die Forderung einer abgeschlossenen Lehre als Voraussetzung für die Ausübung eines Berufes, mit der überwundenen Privilegienherrschaft verband. Mechanisierung und Industrialisierung wurden dem Zunftwesen antithetisch gegenübergestellt. Ein Votum pro technischen Fortschritt war hier in radikaler Weise gleichbedeutend mit dem Votum für die Abschaffung der Zünfte und – im Gegensatz zur Deutschland oder Schweiz! – der Berufslehre.
