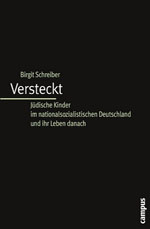 Birgit Schreiber wendet sich mit ihrer Untersuchung ĂŒber versteckte jĂŒdische Kinder im nationalsozialistischen Deutschland einer bisher von der Forschung vernachlĂ€ssigten und spezifischen Gruppe von HolocaustĂŒberlebenden zu. Von besonderem Interesse sind die Lebensthemen der im Versteck ĂŒberlebenden Kinder, ihre spezifischen Verfolgungserfahrungen und ihr Leben danach. Die Studie kennzeichnet zudem eine fĂŒr die qualitative Forschung innovative VerknĂŒpfung zweier Methoden, indem das narrationsstrukturelle Erhebungs- und Auswertungsverfahren mit einer psychoanalytisch orientierten Auswertungsstrategie kombiniert wird.
Birgit Schreiber wendet sich mit ihrer Untersuchung ĂŒber versteckte jĂŒdische Kinder im nationalsozialistischen Deutschland einer bisher von der Forschung vernachlĂ€ssigten und spezifischen Gruppe von HolocaustĂŒberlebenden zu. Von besonderem Interesse sind die Lebensthemen der im Versteck ĂŒberlebenden Kinder, ihre spezifischen Verfolgungserfahrungen und ihr Leben danach. Die Studie kennzeichnet zudem eine fĂŒr die qualitative Forschung innovative VerknĂŒpfung zweier Methoden, indem das narrationsstrukturelle Erhebungs- und Auswertungsverfahren mit einer psychoanalytisch orientierten Auswertungsstrategie kombiniert wird.
Nach einem kurzen Vorwort von Kurt GrĂŒnberg (Sigmund-Freud-Institut Frankfurt) beginnt Birgit Schreiber mit einer Einleitung (Kapitel 1), in der die Untersuchungsgruppe skizziert, das Ziel der Studie dargelegt, der Wert individueller Lebensgeschichten diskutiert und der Zeitpunkt der Untersuchung thematisiert wird. Darauf folgt eine EinfĂŒhrung in das Thema âVersteckt in Deutschlandâ (Kapitel 2), in dem sowohl der Forschungstand und die Datenlage vorgestellt als auch fĂŒr die Untersuchung relevante Begriffe definiert werden, wie beispielsweise âVersteckâ. Auch wird in diesem Kapitel nicht einzig auf die Gruppe der Versteckten eingegangen, sondern ebenso auf diejenigen, die ein Verstecken ermöglichten, die so genannten RetterInnen. Eingebettet sind diese AusfĂŒhrungen stellenweise in einen gesellschaftspolitischen Diskurs, der unter dem Schlagwort âVergangenheitsbewĂ€ltigung in Deutschlandâ zusammengefasst werden kann.
In Kapitel 3 steht die Thematik âTraumatisierungenâ im Mittelpunkt. Der Begriff âTraumaâ wird zunĂ€chst bestimmt und als komplexes Konzept vorgestellt. Mögliche Folgen von Traumatisierungen werden benannt. Nach den zu diesem Thema eher allgemeinen AusfĂŒhrungen von Traumata im Kontext von Sozialisation erfolgt im weiteren Verlauf eine Hinwendung zu Traumatisierungsprozessen von so genannten âchild survivorsâ. Hier finden ausgewĂ€hlte Studien ErwĂ€hnung, die als Folgeerscheinungen von Traumatisierungen u.a. Ăberlebensschuld und Trennungsschuld bei den Betroffenen thematisieren.
Im Kapitel 4 nĂ€hert sich die Autorin der Situation des ErzĂ€hlens einer Lebensgeschichte an. Betitelt mit âDie âKrisen des Zeugnisgebensââ wird auf das Konzept des Zeugnisgebens in Verbindung mit dem ErzĂ€hlen von traumatischen Erfahrungen Bezug genommen. Im Gegensatz zu der oft angenommenen Sprachlosigkeit basiert dieses Konzept auf der Annahme, dass der Wunsch nach Mitteilung bei Betroffenen sehr wohl vorhanden, die Umsetzung aber mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die ErzĂ€hlung ĂŒber das eigene Leben wird dann zum Zeugnis, âwenn sie die Geschichte ĂŒber ihre individuelle Bedeutung hinaus zu einem historischen Dokument macht, das [âŠ] besondere WĂŒrdigung verdientâ (81). Anzumerken ist, dass es der Autorin insgesamt ein Anliegen ist, eine Forschungshaltung einzunehmen, die Interviews mit Verfolgten gelingen lĂ€sst und eine potenzielle Retraumatisierung verhindern soll. Das Konzept âKrise des Zeugnisgebensâ sowie Ăberlegungen zur Lösung dieser Krisen bilden hierfĂŒr den Ausgangspunkt.
AusfĂŒhrungen ĂŒber Methodologie und Methoden finden sich im Kapitel 5, in dem der Rahmen der Untersuchung skizziert wird, die Auswertungsmethoden erlĂ€utert und die Auswertungsschritte dargelegt werden. Zur BegrĂŒndung fĂŒr die Wahl der Auswertungsmethoden (narrationsstrukturelles und psychoanalytisches Vorgehen) wird der spezifische Charakter der Lebensgeschichten von Ăberlebenden, die durch Traumatisierungen gekennzeichnet sind, angefĂŒhrt. Die Autorin nimmt an, dass die gĂ€ngigen Methoden der Biographieforschung die traumatischen Erfahrungen nicht erfassen können, da sie sich der verbalen Ebene entziehen. Der psychoanalytische Ansatz hingegen beinhaltet die Möglichkeit der GegenĂŒbertragungsanalyse, bei der die Reaktionen der ForscherInnen auf die Interviewten reflektiert und (mit)interpretiert werden. Auf diesem Weg lassen sich latent vorhandene Empfindungen, Haltungen oder Strategien erfassen.
Die Kapitel 6 bis 10 beinhalten die Interpretationen von fĂŒnf biographischen Interviews mit damals versteckten Kindern. Jede Interviewinterpretation beginnt mit der Darstellung der Kontaktaufnahme sowie mit einer detaillierten Beschreibung der Rahmenbedingungen des Interviews. Diese Informationen flieĂen in die Interpretation ein bzw. stellen ihren Beginn und Ausgangspunkt dar. Neben einer jeweiligen Kurzbiographie finden sich die Interpretationen der Interviews, die teilweise durch ausgewĂ€hlte Szenen vertieft und durch einen im Weiteren eingenommenen Fokus auf spezifische Lebensthemen ergĂ€nzt werden. Bis auf diese Aspekte existiert eine einheitliche Gliederung der Darstellung nicht, sondern es wird sich an Struktur und Inhalt des jeweiligen Interviews orientiert. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass ein ĂŒber die jeweilige Interviewinterpretation hinausgehender Vergleich mit dem Ziel einer Verallgemeinerung nicht explizit angestrebt wird; die Interpretationen stehen sozusagen fĂŒr sich. Dementsprechend schlieĂt sich in Kapitel 11 eine Reflexion der Erfahrungen mit den Methoden und den âKrisen des Zeugnisgebensâ im Forschungsprozess an, also eine Auseinandersetzung mit dem Forschungsdesign und den damit verbundenen Grundannahmen.
In Kapitel 12 werden dann die âgefundenenâ Lebensthemen einst versteckter Kinder diskutiert. DiesbezĂŒglich schreibt die Autorin: âDas Ăberleben durch Untertauchen bleibt eine individuelle, nicht verallgemeinerbare Erfahrung [âŠ], auch wenn es gemeinsame Bearbeitungsformen und ĂŒbergreifende Themen der in Deutschland versteckten jĂŒdischen Kinder gibtâ (391). Diese Themen sind u.a.: widerstreitende LoyalitĂ€ten und Ambivalenzen hinsichtlich der Heimatgebundenheit oder Sehnsucht nach Anerkennung des erfahrenen Schicksals bei gleichzeitiger Tendenz, sich vor den damit in Verbindung stehenden, schmerzhaften Erinnerungen schĂŒtzen zu wollen. Das Buch endet mit einem Nachwort von Dan Bar-On.
Auffallend ist, dass sich in der Einleitung keine ErlĂ€uterungen finden, die den Aufbau der Studie erklĂ€ren. Die Einleitung beinhaltet zwar eine EinfĂŒhrung in die Thematik, diese lĂ€sst die Leserin bzw. den Leser jedoch eher in das Thema âstolpernâ, als dass sie eine Anleitung bietet. Auch finden sich keine HinfĂŒhrungen zu Beginn der jeweiligen Kapitel. Demzufolge ist die Struktur fĂŒr die Leserschaft schwer nachzuvollziehen und â und dies ist der eigentliche Kritikpunkt â die thematischen Setzungen und theoretischen Rahmungen werden nicht ausdrĂŒcklich durch den Strukturaufbau der Studie begrĂŒndet. Insbesondere der thematische Bezug zu Traumatisierungen lĂ€sst die Frage unbeantwortet, inwieweit hier eine Vorannahme gesetzt wird, die zumindest begrĂŒndungspflichtig ist, da sie weit reichende Konsequenzen fĂŒr das Forschungsdesign nach sich zieht. Sowohl der Bezug zu dem Ansatz âKrisen des Zeugnisgebensâ als auch die Integration psychoanalytischer Perspektiven beruhen auf der Annahme vorhandener Erfahrungen der Traumatisierung.
Die Autorin ist sich sehr bewusst, dass sie sich mit ihrer Untersuchung auf einem sensiblen Forschungsterrain bewegt. Dieses Bewusstsein kommt auf der einen Seite in einigen Abschnitten der Interviewinterpretationen zum Ausdruck, in denen mit FingerspitzengefĂŒhl und Empathie Deutungen der Interviewten nachgezeichnet werden. Auf der anderen Seite finden sich ĂuĂerungen, die eher an eine Haltung der âBesserwissendenâ denken lassen. So wird beispielsweise eine humorvolle Erinnerung eines Interviewpartners als Ausdruck klassifiziert, der âleicht ĂŒber die tatsĂ€chlichen Gefahren eines Lebens mit falscher IdentitĂ€t hinwegtĂ€uschenâ (41) kann. Als ein weiteres Beispiel sei erwĂ€hnt, dass sich eine Interviewpartnerin gegen eine Anonymisierung ausgesprochen hat, Birgit Schreiber sie aber dennoch beibehĂ€lt. Zur BegrĂŒndung schreibt sie: âIch habe ĂŒber ihren Wunsch lange nachgedacht und beschlossen, ihre Geschichte zu ihrem Schutz zu codieren â um alle InterviewpartnerInnen gleich zu behandeln und um sie vor neuen antisemitischen Anfeindungen zu schĂŒtzenâ (16).
Wie bereits erwĂ€hnt, findet sich in der Studie eine VerknĂŒpfung zweier Auswertungsmethoden: der narrationstrukturelle wird mir einem psychoanalytischen Ansatz verbunden. Die Entscheidung fĂŒr die Methoden ist ausgehend von Forschungsfeld und -fragen entwickelt worden, ein Vorgehen, das der Logik qualitativer Forschung ausdrĂŒcklich entspricht. DarĂŒber hinaus ist die Kombination dieser Verfahren selten in der Biographieforschung zu finden, so dass mit der vorliegenden Studie ein innovativer Beitrag vorliegt. Die Anwendung der Methoden im Rahmen der fĂŒnf Interviewinterpretationen ist ĂŒberzeugend. Insbesondere die spezifischen âKrisen des Zeugnisgebensâ der jeweiligen Interviewbegegnung geben einen aussagekrĂ€ftigen Einblick sowohl bezogen auf die Biographie als auch auf die Interviewsituation selbst. Das Konzept ist meines Erachtens interessant fĂŒr die Biographieforschung, unabhĂ€ngig von dem gesetzten Fokus auf Traumatisierungen. Auch die GegenĂŒbertragungsanalyse ĂŒberzeugt an den Stellen, an denen sie Schritt fĂŒr Schritt dargelegt und gedeutet wird. Sicherlich bleibt dieser Ansatz punktuell diskussionswĂŒrdig, da sich die Frage aufdrĂ€ngt, inwieweit diese Deutungen zu stark von der Interviewerin abhĂ€ngig sind; auch bliebe zu klĂ€ren, in welchem VerhĂ€ltnis sie zu gĂ€ngigen GĂŒtekriterien wissenschaftlicher Forschung stehen. Dennoch kann festgehalten werden, dass die Autorin sich ein ungewöhnliches Forschungsdesign gewĂ€hlt hat, das sie ĂŒberzeugend vertritt und anwendet. DarĂŒber hinaus finden sich aber auch Interpretationen, die weder mit der einen noch mit der anderen Methode verbunden werden können und die ĂŒber einen spekulativen Charakter verfĂŒgen. Beispielsweise verlĂ€sst die Rekonstruktion den Rahmen der gewĂ€hlten Methoden, wenn gedeutet wird, dass jemand mit dem Beruf des Lehrers âvielleicht stellvertretend die TrĂ€ume der Mutterâ (142) verwirklichen möchte. Diese Art von Interpretation findet sich gehĂ€uft und wird oftmals mit einem Eindruck, den âmanâ gewonnen hat, begrĂŒndet. Infolgedessen aber verlieren die Interpretationen teilweise ihre Stringenz und der Nachvollzug der Erfahrungen sowie deren Deutungen werden erschwert.
Die Interpretationen der Interviews stellen das âHerzstĂŒckâ der Studie dar, eine Schwerpunktsetzung, die von der Autorin intendiert ist. Hierdurch wird betont, dass die Erfahrungen der ehemals Versteckten nicht verallgemeinerbar sind. Dementsprechend wendet sich das Buch insbesondere an die LeserInnen, die sich fĂŒr die individuelle Verarbeitung von Widerfahrenem und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Biographie in einem spezifisch historischen Kontext interessieren. Entsprechend stehen individuelle Ăberlebensstrategien â verflochten mit den entwickelten Lebensthemen im Kontext von biographischer Arbeit â im Mittelpunkt. Anzumerken ist, dass die Studie nicht in der Vergangenheit verbleibt, sondern aktuelle BezĂŒge aufgreift. Viele der InterviewpartnerInnen leben in Deutschland und sie thematisieren u.a das Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in diesem Land, ein Aspekt, der von der Autorin aufgegriffen und vertieft wird.
Insgesamt ist die Studie von Birgit Schreiber ein mit Sicherheit diskussionswĂŒrdiges und lesenswertes Buch. Trotz der genannten Kritikpunkte gelingt es ihr â und dies gilt nicht fĂŒr alle Untersuchungen im Bereich der Biographieforschung â in den Interviewinterpretationen eindeutig ĂŒber das offensichtlich Gesagte hinauszugehen. In diesem Rahmen ermöglicht sie Einblicke in eine Welt, die tendenziell eher durch Schweigen gekennzeichnet ist.
