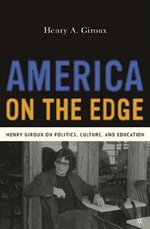 Die US-amerikanische Erziehungswissenschaft wird nicht ohne Grund aus europĂ€ischer Perspektive als vorwiegend pragmatisch orientiert und an der Frage: âwhat worksâ interessiert eingeschĂ€tzt. Dies erklĂ€rt den hohen empirischen Forschungsanteil und die starke sozial- und kognitionswissenschaftliche Ausrichtung bei relativ geringem Anteil geisteswissenschaftlicher BezĂŒge. Daher ist das, was in der deutschen Tradition unter Allgemeiner Erziehungswissenschaft oder Allgemeiner PĂ€dagogik subsumiert wird, eher unterreprĂ€sentiert. Dies mag rein quantitativ betrachtet eine zutreffende Skizzierung der amerikanischen Erziehungswissenschaft sein, bedeutet aber keinesfalls, dass allgemeine den gesellschaftlichen Kontext reflektierende Diskussionen nicht vorkĂ€men und keine wissenschaftliche und öffentliche Bedeutung hĂ€tten. Ein prominenter Vertreter der Allgemeinen PĂ€dagogik, wenn man die Unterscheidung zwischen Erziehungswissenschaft und PĂ€dagogik zugrunde legt, ist Henry A. Giroux. Giroux ist seit vielen Jahren, mittlerweile lĂ€sst sich schon von Jahrzehnten sprechen, ein öffentlicher Intellektueller, der sich ausdrĂŒcklich als PĂ€dagoge im Sinne eines cultural workers, eines Kulturarbeiters, versteht. Mit vielen Wegbegleitern wie beispielsweise Stanley Aronowitz oder Michael Apple teilt er eine kritische Grundorientierung, die sich zu einem signifikanten Teil auf die Frankfurter Schule bezieht. Damit hat er viel mit dem gemein, was auch hierzulande unter kritischer PĂ€dagogik firmiert. Angereichert mit dem Instrumentarium der cultural studies und einer zeitweilig stĂ€rker an Michel Foucault angelehnten Perspektive analysiert und kommentiert er die komplexen Beziehungen zwischen Kultur, Politik und Erziehung amerikanischer gesellschaftlicher Bedingungen.
Die US-amerikanische Erziehungswissenschaft wird nicht ohne Grund aus europĂ€ischer Perspektive als vorwiegend pragmatisch orientiert und an der Frage: âwhat worksâ interessiert eingeschĂ€tzt. Dies erklĂ€rt den hohen empirischen Forschungsanteil und die starke sozial- und kognitionswissenschaftliche Ausrichtung bei relativ geringem Anteil geisteswissenschaftlicher BezĂŒge. Daher ist das, was in der deutschen Tradition unter Allgemeiner Erziehungswissenschaft oder Allgemeiner PĂ€dagogik subsumiert wird, eher unterreprĂ€sentiert. Dies mag rein quantitativ betrachtet eine zutreffende Skizzierung der amerikanischen Erziehungswissenschaft sein, bedeutet aber keinesfalls, dass allgemeine den gesellschaftlichen Kontext reflektierende Diskussionen nicht vorkĂ€men und keine wissenschaftliche und öffentliche Bedeutung hĂ€tten. Ein prominenter Vertreter der Allgemeinen PĂ€dagogik, wenn man die Unterscheidung zwischen Erziehungswissenschaft und PĂ€dagogik zugrunde legt, ist Henry A. Giroux. Giroux ist seit vielen Jahren, mittlerweile lĂ€sst sich schon von Jahrzehnten sprechen, ein öffentlicher Intellektueller, der sich ausdrĂŒcklich als PĂ€dagoge im Sinne eines cultural workers, eines Kulturarbeiters, versteht. Mit vielen Wegbegleitern wie beispielsweise Stanley Aronowitz oder Michael Apple teilt er eine kritische Grundorientierung, die sich zu einem signifikanten Teil auf die Frankfurter Schule bezieht. Damit hat er viel mit dem gemein, was auch hierzulande unter kritischer PĂ€dagogik firmiert. Angereichert mit dem Instrumentarium der cultural studies und einer zeitweilig stĂ€rker an Michel Foucault angelehnten Perspektive analysiert und kommentiert er die komplexen Beziehungen zwischen Kultur, Politik und Erziehung amerikanischer gesellschaftlicher Bedingungen.
Der vorliegende Band, der teils an anderen Orten veröffentlichte BeitrÀge versammelt, fragt nach den sowohl theoretischen wie handlungspraktischen Konsequenzen dessen, was als konservative, autoritative und antidemokratische Wende in der amerikanischen Politik wahrgenommen wird. Anders gesagt, es geht um eine exemplarische linke Analyse des Nexus von Politik, Kultur und Erziehung.
Der Band wir mit einem Interview eröffnet, in dem Giroux einige grundsĂ€tzliche Ăberlegungen zur Critical Pedagogy und den Aufgaben des öffentlichen Intellektuellen anstellt. In der hier artikulierten Programmatik wird bereits deutlich, dass Giroux die Rolle des distanzierten Beobachters und nĂŒchternen Analytikers ablehnt und stattdessen auf die Praxis einwirken, diese verĂ€ndern will. In den USA, so seine Ăberzeugung, herrsche zurzeit augenscheinlich ein Klima, das der selbstkritischen Reflexion eher entgegenstehe: âThe United States has become a country that appears to have lost its willingness to be reflective about both its role in the world and its actions at homeâ (11). Damit sieht er fĂŒr sich keine Möglichkeit mehr, sein Projekt â die Untersuchung der Beziehungen zwischen materialen Strukturen und dem, was er als pedagogical force of cultural politics nennt â zu verfolgen. Sein Wechsel an eine kanadische UniversitĂ€t ist Ausdruck der Reaktion nicht nur verĂ€nderter persönlicher Arbeitsbedingungen, sondern auch der bereits angesprochenen grundsĂ€tzlichen gesellschaftlichen Umorientierung. In Bezug auf Bildung und Erziehung sieht er diese vor allem im Verlust des öffentlichen Raums und der Re-Definition von Bildung als einem kommodifizierten und nicht mehr öffentlichem Gut. Damit verbunden ist seiner Meinung nach sowohl ein reduziertes VerstĂ€ndnis von StaatsbĂŒrgerschaft, das sich in erster Linie konsum- und geldorientiert zeige, als auch, damit einhergehend, der Verlust gesellschaftlicher SolidaritĂ€t, die er mit dem Begriff des Gesellschaftsvertrags belegt. Mit dieser Beschreibung der VerĂ€nderungen in den USA sind keine Technikfeindlichkeit und kein Verwerfen populĂ€rer Kultur impliziert. Im Gegenteil: Gerade aus pĂ€dagogischer Sicht hĂ€lt Giroux es fĂŒr unabdingbar, dass die technologischen Entwicklungen in ihren Implikationen fĂŒr Bildung und Erziehung nicht unterschĂ€tzt, sondern ausdrĂŒcklich adressiert werden.
Auf diese Einleitung folgen sechs Teile, die eine unterschiedliche Anzahl von BeitrĂ€gen vereinen. Der erste groĂe Teil beschĂ€ftigt sich mit dem, was Giroux Demokratiekrise und Autoritarismus nennt. Der gemeinsam mit Susan Searls Giroux verfasste Artikel nimmt die Beziehung zwischen Demokratie und der Krise der öffentlichen Bildung in den Blick. Ein weiterer Text befasst sich mit den Implikationen der Gefangenenmisshandlung im Irak und trĂ€gt den provokanten Titel âFrom Auschwitz to Abu Ghraib; Rethinking Education as Public Pedagogyâ. Der zweite groĂe Teil, ĂŒberschrieben mit âAgainst Fundamentalism; Resisting Religious Extremism and Market Orthodoxyâ, vereint zwei BeitrĂ€ge, welche die PrĂ€senz des Religiösen in der rechten Politik und das Eindringen ökonomischer Denkmuster in die Bildungsinstitutionen thematisieren bzw. kritisieren. Der dritte Teil befasst sich in ebenfalls drei BeitrĂ€gen mit dem Oberthema MedienpĂ€dagogik. Im vierten Teil werden Aspekte der Ăberwachungspolitik und Fragen der sozialen Gerechtigkeit diskutiert. Parallel dazu befassen sich zwei weitere BeitrĂ€ge mit der Militarisierung des öffentlichen Diskurses, die bis zum Hollywood-Film verfolgt wird. Die letzten drei BeitrĂ€ge sind programmatisch auf eine âPolitik der Hoffnungâ ausgerichtet.
Wie dieser knappe Ăberblick zeigt, handelt es sich bei den in diesem Buch versammelten BeitrĂ€gen um ein Thema mit Variationen. Dem/der Lesenden begegnet ein Argument oder Beispiel an verschiedenen Stellen des Buches. Im Grunde lieĂe sich auch sagen, dass die zentralen BezĂŒge bereits im einfĂŒhrenden Interview zur Sprache gebracht und dann in den folgenden BeitrĂ€gen entfaltet und nĂ€her bestimmt werden. Dabei sollte man die Verortung Girouxâ ernst nehmen. Er schreibt als öffentlicher Intellektueller, nicht als Wissenschaftler. Die Argumentation wird hĂ€ufig mit einem polemischen Gestus vorgetragen.
Um einen Einblick zu vermitteln, werde ich den gemeinsam mit Susan Searls Giroux verfassten Beitrag âDemocracy and the Crisis of Public Educationâ vorstellen und an zentralen Stellen mit den anderen BeitrĂ€gen verbinden. Die Verfassenden beklagen zunĂ€chst die weit verbreitete Tendenz, StaatsbĂŒrgerschaft nicht lĂ€nger mit Freiheit, SolidaritĂ€t und Partizipation zu verbinden, sondern als An- und Verkauf von Waren aufzufassen (44). Ein allgemeiner RĂŒckzug aus der SphĂ€re des Politischen sei die Folge.
Diese Tendenz finde ihren Gegenpart in einer Politik, die sich nicht mehr damit befasse, mit welchen MaĂnahmen Chancengleichheit begĂŒnstigt werden könne, sondern sich auf punitive und sicherheitsorientierte Handlungen beschrĂ€nke. Dieses Thema wird im vierten Teil nochmals dezidiert aufgenommen. Neben diesem Trend sei ein weiterer zu verzeichnen: eine allgemeine GeringschĂ€tzung gegenĂŒber Bildung und Erziehung. Dies fĂŒhrt Henry Giroux darauf zurĂŒck, dass mit dem auf Steigerung von Verteilungsgerechtigkeit und Chancengleichheit fĂŒr Minderheiten zielenden Engagement ein Backslash eingesetzt habe, in dessen Verlauf ein auf individuellen Rechten begrĂŒndetes ErziehungsverstĂ€ndnis FuĂ fasse. Die Programme freier elterlicher Schulwahl und Privatisierung spiegelten diese verĂ€nderte Auffassung wider. Mit der Publikation von âA Nation at Riskâ unter der Reagan-Administration sei dieser Trend noch weiter verstĂ€rkt worden. In dieser Beschreibung galten Schulen als âbig government monopolyâ (vgl. 44), ineffizient und ineffektiv, nicht in der Lage, Amerikas SchĂŒlerpopulation fĂŒr die Erfordernisse der globalisierten Welt zu qualifizieren. Ăhnlich wie die Schulen sei auch der tertiĂ€re Bildungssektor unter Privatisierungsdruck geraten â auch dieses Thema wird an anderer Stelle nochmals aufgenommen. Seien die Schulen auf das BeschĂ€ftigungssystem hin orientiert, so seien die UniversitĂ€ten nach dem unternehmerischen Modell gestaltet. Nicht mehr die vielfĂ€ltigen â nicht zuletzt auch öffentlichen â Aufgaben der Professorenschaft stĂ€nden im Mittelpunkt, sondern die Höhe der eingeworbenen Mittel. Beide Institutionen, die Schulen und die Hochschulen, wĂŒrden damit ihres öffentlichen Charakters verlustig gehen.
Die beiden angesprochenen Entwicklungen â ein breiter RĂŒckzug aus der politischen Beteiligung und die Missachtung der Erziehung â seien zwar nicht neu, wĂŒrden aber selten in einem Zusammenhang gesehen. So komme es, dass auch die mit Erziehung befassten Aktivisten selten die BrĂŒcke zur demokratischen Funktion der Erziehung schlĂŒgen und sich stattdessen der allgemeinen Orientierung direkt anschlössen: Erziehung diene in erster Linie der Qualifikation und der Vorbereitung fĂŒr den Arbeitsmarkt. Als Beleg fĂŒr die kombinierte Krise des Erzieherischen und des Politischen fĂŒhren sie die weitgehend unhinterfragte Aneignung der offiziellen Darstellung zum Hintergrund des Irakkrieges an und fragen rhetorisch: What does this represent, if not a crisis of pedagogy â both formally and informally â in the public sphere? (45).
Besonders hart geht das Autorenteam mit den Medien ins Gericht, die entweder parteilich oder unfĂ€hig seien, ihre Rolle als kritische Instanzen wahrzunehmen. Die Kombination aus KomplizitĂ€t und UnfĂ€higkeit fĂŒhre dann dazu, dass die enormen Summen, die der Irakkrieg verschlinge, ebenso selbstverstĂ€ndlich bereit gestellt wie die vergleichsweise sehr bescheidenen Summen zur Investition in die Erziehung besonders bedĂŒrftiger SchĂŒler und SchĂŒlerinnen verwehrt wĂŒrden. Hinzu komme dann noch eine moralisch-ethische Krise, deren Inbegriff die mit dem Namen Abu Ghraib verbundenen Ereignisse seien. Das komplexe Beziehungsgeflecht aus Wirtschaftsinteressen, einer tendenziell antidemokratischen Politik und Medieneinfluss gekoppelt mit einer Entwertung von Erziehung, die nur auf ihre allokativen Aufgaben orientiert werde, fĂŒhre, so Henry und Susan Giroux, zu einer Fehlentwicklung im amerikanischen DemokratieverstĂ€ndnis. Als Kronzeuge wird unter anderem John Dewey angerufen, der, ebenso wie bereits Thomas Jefferson, immer auf den engen Zusammenhang von Demokratie und dem Bildungsniveau der Bevölkerung aufmerksam gemacht habe. â Diese Perspektive gĂ€lte es einzufordern und zurĂŒck zu gewinnen, so die abschlieĂende Forderung der Autoren.
Sicher wĂ€re hier unter ideologiekritischer Perspektive viel zu kommentieren, nicht zuletzt auch in Bezug auf unterschiedliche Traditionen im VerhĂ€ltnis von WissenschaftsverstĂ€ndnis und politischen BezĂŒgen. All dies möchte ich hier nicht zum Thema machen, aber eines sollte bedacht werden. Erziehung und Bildung sind immer gesellschaftlich umkĂ€mpfte Begriffe. Die Verschiebung in der Bedeutung, von der Giroux spricht, ist jenseits aller Ideologiekritik auch auĂerhalb der USA zu beobachten, und die Frage, wie sich die Vorstellung von Bildung und Erziehung als individuellem Recht zum Konstrukt des Gesellschaftsvertrags verhalten und welche Rechte darin die der Minderheiten spielen, ist durchaus zu diskutieren. Dahinter steht die grundlegende Frage, zu der sich die PĂ€dagogik verhĂ€lt und die Erziehungswissenschaft reflektiert nach dem VerhĂ€ltnis zwischen individuellen und Gruppenrechten, nach individuellen und kollektiven IdentitĂ€ten.
