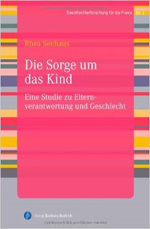 Nimmt man den Titel nur flĂŒchtig wahr, so kann der Eindruck entstehen, dass Rhea Seehaus den zeitgenössischen Diskurs um Elternschaft trifft. Dieser markiert Elternschaft entweder skandalisierend als soziales Problem oder positivistisch als Herausforderung, insbesondere fĂŒr die âneuen VĂ€terâ. Die qualitative Studie widersetzt sich dieser hĂ€ufig individualisierenden Rede um das Wohl des Kindes und die darauf bezogene Positionierung der Eltern als Verantwortungstragende. Stattdessen setzt sie am âsozialen Konstruktionscharakter von Elternverantwortung an und rĂŒckt die Perspektive der Eltern in den Fokusâ und fragt, âwie Eltern ihre Verantwortung in AbhĂ€ngigkeit von derzeitigen Anforderungen und spezifischen Kontexten ausgestaltenâ (10). Indem Seehaus diese Perspektiven anhand von Interviews in ihrer Dissertation empirisch untersucht, rĂŒckt sie auch die auf den ersten Blick triviale Feststellung in den Vordergrund, dass die Transformation von der Paarkonstellation zu diesen spezifischen, ânicht-reziproken Sorgebeziehungenâ (ebd.) weitestgehend irreversibel ist. Aus modernisierungs- und geschlechtertheoretischen Perspektiven wird vor dem Hintergrund der IrreversibilitĂ€t hĂ€ufig diskutiert, weshalb sich Eltern den mit der Geburt des Kindes eintretenden Fremd- und Selbstpositionierungen (nicht) entziehen können. Die Autorin wiederum perspektiviert die Eltern als in und durch diese Transformation ent- und zugleich ermĂ€chtigte Subjekte, die sich in ihren ErzĂ€hlungen selbst positionieren und zu positionieren haben. Dabei orientiert sich die Studie analytisch insbesondere am von Althusser ĂŒber Butler in den Geschlechterdiskurs getragenen Konzept der âAnrufungâ und verortet sich theoretisch zwischen einer erziehungswissenschaftlichen Elternforschung sowie der Geschlechter- und Kindheitsforschung. Die empirische Basis der Studie bilden Interviews mit Eltern aus Ăsterreich, der Schweiz und Deutschland â allerdings sind es, darauf weist Seehaus selbstkritisch hin, Eltern aus der âMittel- und Oberschichtâ, die in âheterosexuellen Partnerschaftenâ leb(t)en (52f).
Nimmt man den Titel nur flĂŒchtig wahr, so kann der Eindruck entstehen, dass Rhea Seehaus den zeitgenössischen Diskurs um Elternschaft trifft. Dieser markiert Elternschaft entweder skandalisierend als soziales Problem oder positivistisch als Herausforderung, insbesondere fĂŒr die âneuen VĂ€terâ. Die qualitative Studie widersetzt sich dieser hĂ€ufig individualisierenden Rede um das Wohl des Kindes und die darauf bezogene Positionierung der Eltern als Verantwortungstragende. Stattdessen setzt sie am âsozialen Konstruktionscharakter von Elternverantwortung an und rĂŒckt die Perspektive der Eltern in den Fokusâ und fragt, âwie Eltern ihre Verantwortung in AbhĂ€ngigkeit von derzeitigen Anforderungen und spezifischen Kontexten ausgestaltenâ (10). Indem Seehaus diese Perspektiven anhand von Interviews in ihrer Dissertation empirisch untersucht, rĂŒckt sie auch die auf den ersten Blick triviale Feststellung in den Vordergrund, dass die Transformation von der Paarkonstellation zu diesen spezifischen, ânicht-reziproken Sorgebeziehungenâ (ebd.) weitestgehend irreversibel ist. Aus modernisierungs- und geschlechtertheoretischen Perspektiven wird vor dem Hintergrund der IrreversibilitĂ€t hĂ€ufig diskutiert, weshalb sich Eltern den mit der Geburt des Kindes eintretenden Fremd- und Selbstpositionierungen (nicht) entziehen können. Die Autorin wiederum perspektiviert die Eltern als in und durch diese Transformation ent- und zugleich ermĂ€chtigte Subjekte, die sich in ihren ErzĂ€hlungen selbst positionieren und zu positionieren haben. Dabei orientiert sich die Studie analytisch insbesondere am von Althusser ĂŒber Butler in den Geschlechterdiskurs getragenen Konzept der âAnrufungâ und verortet sich theoretisch zwischen einer erziehungswissenschaftlichen Elternforschung sowie der Geschlechter- und Kindheitsforschung. Die empirische Basis der Studie bilden Interviews mit Eltern aus Ăsterreich, der Schweiz und Deutschland â allerdings sind es, darauf weist Seehaus selbstkritisch hin, Eltern aus der âMittel- und Oberschichtâ, die in âheterosexuellen Partnerschaftenâ leb(t)en (52f).
Die erzĂ€hlten Varianten der Techniken der Positionierungen differenziert Rhea Seehaus sowohl hinsichtlich verschiedener GegenstĂ€nde der elterlichen Sorge als auch â und dies macht die Analysen besonders aufschlussreich â als binnendifferenzierende Paarpraxis. Der empirische Teil untergliedert sich in drei Kapitel:
Erstens kategorisiert die Autorin in âWer sorgt fĂŒr das Kind? Elterliche Aufteilung von Sorgearbeitâ die Interviewsequenzen unter den Aspekten der feminisierten Sorgearbeit und den Sorgekonzepten âaktiver Vaterschaftâ. Hier konstatiert sie zwar â Ă€hnlich wie andere Autor/innen der Geschlechterforschung â eine âdeutliche Kluft zwischen den in den aktuellen Elternschafts- und Familiendiskursen verbreiteten Formen egalitĂ€rer Arbeitsteilungsmuster und den Darstellungen der Eltern bezĂŒglich ihrer ZustĂ€ndigkeitenâ (121). Dieser Widerspruch selbst bildet jedoch nicht den analytischen Ausgangspunkt von Seehaus. Dieser ist vielmehr die Art und Weise, wie Eltern diesen Widerspruch darstellen und vor allem plausibilisieren. Damit gelangt Rhea Seehaus zu alternativen Perspektiven auf die gegenseitigen, geschlechterdifferierenden Positionierungen, wenn bspw. ein Vater von der Mutter als âBackup-Lösungâ (80) adressiert wird oder in der Darstellung einer anderen Mutter diese die Arbeitsteilung naturalisiert, indem sie das Kind als âmein Kindâ positioniert und damit den Vater des Kindes als auĂenstehende Person konstruiert (75). Ebenfalls exemplarisch fĂŒr diese wechselseitigen Positionierungen steht die Aussage einer Mutter, die die Transformation ihres Partners hin zum Vater im Vergleich zu sich als Mutter als weniger intensiv beschreibt, da dieser seinen sozialen Kontakten nach wie vor nachgeht (63). An Sequenzen wie diesen arbeitet die Autorin heraus, dass zentrale Referenzpunkte hierbei nicht nur die âNaturâ des Sachverhalts oder strukturelle BegrĂŒndungen sind, sondern auch das Wohl des Kindes. So zeigt sie anhand der Interviewsequenzen, wie differenziert Eltern das diskursive (und in sich widersprĂŒchliche) Geschehen etwa um die Leitnorm der egalitĂ€ren Elternschaft und den damit implizierten Geschlechterordnungen, welche an sie gerichtet und in welche sie eingebettet sind, wahrnehmen und reflektieren. Diese Leitnormen werden zugleich in der intimen Aushandlung um Elternverantwortung aufgerufen und argumentativ integriert. Folglich wird hier das VerhĂ€ltnis von diskursiven Anrufungen und elterlichen (Sorge-)Praktiken sichtbar.
Im zweiten empirischen Teil diskutiert Rhea Seehaus unter dem Aspekt âEntwicklung unter Assistenz â Gegenstand elterlicher Sorgearbeitâ die Bearbeitung der an Eltern gerichteten Anforderung der angemessenen Begleitung der kindlichen Entwicklung. Hier analysiert die Autorin u. a. die Paradoxie, dass in den Darstellungen der Eltern die âEntwicklungâ des Kindes dem Muster der âAutopoiesisâ folgt. Dieses entpflichtet die MĂŒtter und VĂ€ter allerdings nicht. Vielmehr ruft diese spezifische Perspektive auf die Entwicklung des Kindes die Eltern dazu auf, das Kind noch intensiver zu beobachten und zugleich ihr eigenes Handeln zu evaluieren, um es wiederum âkindgerechtâ zu optimieren (152). VerknĂŒpft man diese Ergebnisse mit Analysen von bildungspolitischen, aber auch fachlichen Diskursen in und um frĂŒhe Kindheit, so lĂ€sst sich das Konzept der âAutopoiesisâ als eine der zentralen Leitideen zeitgenössischer Kindheit herausarbeiten, die spezifische Handlungsroutinen beschreiben und alle beteiligten Erwachsenen entsprechend gegenĂŒber dem Kind positionieren.
Drittens fokussiert Rhea Seehaus in â(Selbst-)Formierung der Elternsorge im Kontext der kindermedizinischen Untersuchungenâ die differenten Schnittstellen zwischen privaten und kindermedizinischen VerantwortungsĂŒbernahmen und -zuteilungen. Diese, nun an das DFG-Projekt âKinderkörper in der Praxisâ [1], anschlieĂende Fokussierung stellt u. a. das diffizile Grenzmanagement heraus, welches im Prozess zwischen der Sichtbarmachung von Ă€rztlicher und elterlicher ProfessionalitĂ€t hergestellt wird. Hier ist bspw. die Herausarbeitung der Argumentationsfigur des âkompetentenâ und âeigensinnigen Kind[es]â zu benennen: Diese Figur konfiguriert âdurch seinen Eigenwillen die elterliche Sorgepraxisâ (224) und kann dazu genutzt werden, um die öffentlichen Anrufungen zu relativieren, die die âĂnderung der elterlichen Sorgepraxis einfordernâ (ebd.). Seehausâ Analyse des diskursiven RĂŒckgriffs auf Kindfiguren, die das fĂŒrsorgerische Handeln Erwachsener verunmöglichen, erweist sich auch fĂŒr weitere kindheitstheoretische Arbeiten, die im Schnittfeld von öffentlicher und privater SorgetĂ€tigkeiten forschen, als sehr produktiv.
Insgesamt macht diese wiederkehrende hohe AnschlussfĂ€higkeit der empirischen Ergebnisse an aktuelle kindheits-, geschlechter- und familientheoretische Diskurse die QualitĂ€t der Studie aus. Zugleich bleiben auch Fragen offen: So lĂ€sst sich nicht umstandslos erschlieĂen, weshalb das Sample Interviews in drei LĂ€ndern umfasst, da letztlich kein systematischer transnationaler Vergleich durchgefĂŒhrt wird. Zugleich aber geben die Ergebnisse fĂŒr â teils nach wie vor getrennte â Diskursfelder zentrale Hinweise fĂŒr deren weitere empirisch-theoretische Ausdifferenzierung: So mahnt die Studie an, die Binnendifferenz innerhalb von â in diesem Fall heterosexueller â Elternschaft und deren wechselseitige Zuschreibungspraxen analytisch differenzierter wahrzunehmen. Dabei zeichnet Seehaus nach, wie das Paar hin zur Familie verschiedene â und im Prinzip unabgeschlossene â Formen der Transition durchlĂ€uft und schlieĂt mit diesen Analysen an transitionstheoretische Debatten an. Zudem arbeitet sie heraus, dass auch innerhalb der Elternpaare wechselseitige Beobachtungen und geschlechtersegregierende Statuszuweisungen stattfinden. ResĂŒmierend heiĂt es auch, dass âEltern nicht nur verantwortlich gemacht werden, sie arbeiten â im Kontext der gesellschaftlichen Anforderungen, Normen und Institutionalisierungen â auch selbst aktiv an diesen Positionierungenâ (246). Die von Rhea Seehaus prĂ€zise analysierten wechselseitigen Adressierungen haben, wenn sie in der Interviewsituation artikuliert wurden, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wirklichkeitskonstituierenden Charakter im familiĂ€ren Alltag. Diesem weiter zu folgen wĂ€re ein weiteres ertragreiches empirisches Unterfangen.
[1] Kelle, H. (Hrsg.): Kinder unter Beobachtung. Kulturanalytische Studien zur pÀdiatrischen Entwicklungsdiagnostik. Opladen u. a.: Barbara Budrich 2010.
