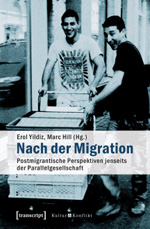 Die Erkenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland und dass Migration normal ist, wird nach jahrelangen ideologischen Kontroversen mittlerweile in Politik, Wirtschaft und Medien breit geteilt. In den Sozialwissenschaften besinnt man sich darauf, dass es auch eine Existenz ânach der Migrationâ gibt â genauer: dass Einwanderung zu AnsĂ€ssigkeit fĂŒhrt, dass aus Eingewanderten deutsche StaatsbĂŒrgerInnen geworden sind und werden, die mittlerweile auch Kinder und Enkelkinder haben, die im Einwanderungsland geboren wurden und werden. Insofern erscheint es angebracht, das Migrationsland Deutschland und seine Geschichte aus einer âpostmigrantischen Perspektiveâ zu betrachten. Das Erkenntnisinteresse, des von Erol Yildiz und Marc Hill herausgegebenen Readers liegt darin, Migration âradikal neu zu denken und zwar jenseits des hegemonialen Diskursesâ sowie âneue Perspektiven auf Migration aufzuzeigenâ, welche die âErfahrungen von Migration in den Blick nehmenâ (11). Ihr âMottoâ lautet daher: âMigration bewegt und bildet die Gesellschaftâ (12). In allen BeitrĂ€gen wird der Versuch unternommen, so Yildiz und Hill, âgĂ€ngige Klassifizierungen und binĂ€re Kategorien zu suspendieren, dafĂŒr hybride, mehrdeutige und "mehrheimische" Perspektiven ins Blickfeld zu rĂŒcken. Dies ermöglicht, gesellschaftliche VerhĂ€ltnisse neu zu denken [âŠ] (so werden) andere LebensentwĂŒrfe, Geschichten und neue Genealogien der Gegenwart sichtbar, jenseits nationaler Narrative und Polarisierungenâ (16). Ich werde den Verdacht nicht los (vgl. die Sprache), dass die Autoren primĂ€r fĂŒr ihre Zunft schreiben, die âScientific Communityâ und fĂŒr sich selbst, nicht fĂŒr ein breites migrationspolitisch interessiertes oder betroffenes Publikum â wozu dann kritische Migrationsforschung?
Die Erkenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland und dass Migration normal ist, wird nach jahrelangen ideologischen Kontroversen mittlerweile in Politik, Wirtschaft und Medien breit geteilt. In den Sozialwissenschaften besinnt man sich darauf, dass es auch eine Existenz ânach der Migrationâ gibt â genauer: dass Einwanderung zu AnsĂ€ssigkeit fĂŒhrt, dass aus Eingewanderten deutsche StaatsbĂŒrgerInnen geworden sind und werden, die mittlerweile auch Kinder und Enkelkinder haben, die im Einwanderungsland geboren wurden und werden. Insofern erscheint es angebracht, das Migrationsland Deutschland und seine Geschichte aus einer âpostmigrantischen Perspektiveâ zu betrachten. Das Erkenntnisinteresse, des von Erol Yildiz und Marc Hill herausgegebenen Readers liegt darin, Migration âradikal neu zu denken und zwar jenseits des hegemonialen Diskursesâ sowie âneue Perspektiven auf Migration aufzuzeigenâ, welche die âErfahrungen von Migration in den Blick nehmenâ (11). Ihr âMottoâ lautet daher: âMigration bewegt und bildet die Gesellschaftâ (12). In allen BeitrĂ€gen wird der Versuch unternommen, so Yildiz und Hill, âgĂ€ngige Klassifizierungen und binĂ€re Kategorien zu suspendieren, dafĂŒr hybride, mehrdeutige und "mehrheimische" Perspektiven ins Blickfeld zu rĂŒcken. Dies ermöglicht, gesellschaftliche VerhĂ€ltnisse neu zu denken [âŠ] (so werden) andere LebensentwĂŒrfe, Geschichten und neue Genealogien der Gegenwart sichtbar, jenseits nationaler Narrative und Polarisierungenâ (16). Ich werde den Verdacht nicht los (vgl. die Sprache), dass die Autoren primĂ€r fĂŒr ihre Zunft schreiben, die âScientific Communityâ und fĂŒr sich selbst, nicht fĂŒr ein breites migrationspolitisch interessiertes oder betroffenes Publikum â wozu dann kritische Migrationsforschung?
Der Band umfasst drei Hauptkapitel: âMigration bewegt die Forschungâ (mit BeitrĂ€gen von Erol Yildiz, Regina Römhild, Sabine Hess, Elke Tschernokoshewa und Mark Terkessidis), âMigration bewegt die Stadtâ (mit AufsĂ€tzen von Wolf-Dietrich Bukow, dem als spiritus rector dieser Forschungsrichtung der Reader zum 70. Geburtstag gewidmet ist, Elke Krasny, Amila Sirbegovic, Angela Pilch Ortega, Marc Hill sowie Miriam Yildiz) und âMigration bewegt den Kulturbetriebâ (mit Artikeln von Natalie Bayer, Brigitte Hipfl, Viktorija Ratkovic, Rosa Reitsamer / Rainer Prokop sowie Katrin Ackerl Konstantin / Rosalie Kopeinig). Da ich in dieser Rezension nicht auf alle BeitrĂ€ge ausfĂŒhrlich eingehen kann, konzentriere ich mich auf die Artikel der Herausgeber sowie die BeitrĂ€ge der KollegInnen, die eigens auf dem Umschlagtext erwĂ€hnt werden:
Erol Yildiz versteht in seinem programmatischen Beitrag âpostmigrantische Perspektivenâ als Ausdruck eines âAufbruch[s] in eine neue Geschichtlichkeitâ. Er orientiert sich dabei stark am sog. âPostkolonialismusdiskursâ, um sich vom dominanten Migrationsdiskurs zu distanzieren, um Migrationsforschung âneu zu denkenâ und (auch) als âGesellschaftsforschungâ zu betreiben. Der âbinĂ€ren Logikâ, dem Denken in Dualismen (âWir und die Anderenâ) und einer am Nationalstaat orientierten homogenen Auffassung von âKulturâ und âIdentitĂ€tâ werden Konstrukte wie âHybriditĂ€tâ, âDifferenzâ und âAmbivalenzâ entgegengesetzt, um quasi eine âpostkoloniale Gegenmoderneâ zu entwerfen: âDie Idee der "Postmigration" (bedeutet) zunĂ€chst, die Geschichte der Migration neu zu erzĂ€hlen und das gesamte Feld der Migration radikal neu zu denken, und zwar indem die Perspektiven derer eingenommen werden, die Migrationsprozesse direkt oder indirekt erlebt habenâ (21). Problematisch ist dieses Postulat m.E., da es dem zu Recht kritisierten âbinĂ€renâ (dualistischen) Denken verhaftet bleibt (hegemonialer Diskurs einerseits, neue Perspektive andererseits) und MigrationsforscherInnen â mit und ohne Migrationserlebnis oder Perspektive â ebenfalls binĂ€r konstruiert, wobei u.a. unklar bleibt, was z.B. âindirektes Erleben von Migrationsprozessenâ meint.
Auch Regina Römhild konstatiert in ihrem Essay âJenseits ethnischer Grenzenâ eingangs eine âpostmigrantische Gesellschaftâ, diskutiert und kritisiert Termini wie âKulturâ (als âgefĂ€hrliche Ideeâ) sowie âkulturalisierende Zuschreibungenâ und eine âPolitik der Ethnisierungâ (37f). Dagegen postuliert sie wortgewaltig, die âMigrationsforschung zu "entmigrantisieren", die Forschung ĂŒber Gesellschaft und Kultur dagegen zu âmigrantisierenââ (39), um schlieĂlich alle gĂ€ngigen Themen und Termini der Migrantionsforschung zu âkosmopolitisierenâ. Ziel und Fazit sind schlieĂlich, âvon der âMigrantologieâ zur postmigrantischen Kultur- und Gesellschaftsforschungâ zu gelangen (40ff) â alles klar? Mit Beispielen aus der Jugendkultur(en)forschung garniert sie ihre These, dass gesellschaftliche RĂ€ume und Orte in dieser neuen theoretischen und praktischen Perspektive nunmehr migrantisiert und kosmopolitisiert betrachtet werden sollten. Das sind starke Termini und Postulate, die auf Ăber- bzw. Umsetzung drĂ€ngen.
Sabine Hess kritisiert die kulturalistische und problembehaftete Betrachtung des Themas Migration / Einwanderung, das gĂ€ngige âIntegrationsparadigmaâ sowie einen âmethodologischen Nationalismusâ (49ff). Sie spricht von einem âkulturalistischen und differentialistischen Rassismusâ, von der âDominanz des essentialistischen Kulturbegriffsâ, einem ethnisierten Integrationsdiskurs sowie der âReligiösisierung der Einwanderungsthematikâ und einer ââökonomistischen Verwertungslogikâ â alles O.K. und abstrakt-theoretisch trefflich formuliert â nur: Wie erklĂ€r ichâs meinem Nachbarn, der abends zum Stammtisch geht? Weiter fĂ€llt mir auf, dass Hess es tunlichst vermeidet, auf die seit Jahren in Deutschland Ă€hnlich gelagerte kritische Diskussion zu dieser Thematik einzugehen â was auch in ihrem Abriss der jĂŒngsten Geschichte der deutschen Migrationsforschung deutlich wird (54ff). In anderen Worten: Ich ertappe mich beim Lesen immer wieder dabei zu denken: âDas hast Du (oder auch andere) doch vor zig Jahren Ă€hnlich geschriebenâ [vgl. exemplarisch 2 oder 3]!? Auch die Formulierung, âdie bisherige Blickrichtung vom Kopf auf die FĂŒĂe zu stellenâ (59), kommt mir sehr bekannt vor, habe ich doch 1984 [vgl. 3, 21ff] mit Blick auf Karl Marx als Fazit einen âAufrufâ formuliert, âdie AuslĂ€nderpĂ€dagogik vom Kopf auf die FĂŒĂe zu stellenâ â das war vor ĂŒber 30 Jahren [vgl. auch den Untertitel zu 3]!
Mit dem Ziel einer âBetriebsprĂŒfung Kulturâ widmet sich Mark Terkessidis in seinem Beitrag dem Thema âKultur und Ăkonomieâ. Dabei kritisiert er, ausgehend von einem Hinweis auf das âerfolgreichste Sachbuch der letzten Jahrzehnteâ von Thilo Sarrazin den am (Bildungs-)BĂŒrgertum orientierten traditionellen Kulturbetrieb, der seiner Meinung nach die aktuelle Situation einer Einwanderungsgesellschaft, vor allem in den (westdeutschen) GroĂstĂ€dten, in denen âVielheit als NormalitĂ€tâ erscheint, nicht gerecht wird und âneu justiertâ werden mĂŒsste. Alternativ entwirft er ein âProgramm Interkulturâ (ohne den Begriff Interkultur zu problematisieren!), welches sich am Konzept der âinterkulturellen Ăffnung [âŠ] auch fĂŒr den Kulturbereichâ orientiert (92): âWenn sich die Kultureinrichtungen an die ganze Bevölkerung richten soll, muss in ihrem Personal auch die ganze Bevölkerung reprĂ€sentiert seinâ (99). Ist das programmatische Ziel der gleichberechtigten Partizipation aller Individuen an und ihrer Nutzung von kulturellen Einrichtungen, âunabhĂ€ngig von deren Herkunftâ nicht neu, kommt mir der im Titel genannte Aspekt der âĂkonomieâ zu kurz.
In seinem Beitrag âMobilitĂ€t und DiversitĂ€t als Herausforderungen fĂŒr eine inclusive cityâ beginnt Wolf-Dietrich Bukow mit der These, dass man mit Blick auf die letzten 50 Jahre âdurchaus von einer neuen MobilitĂ€t und einer neuen DiversitĂ€tâ in der (Stadt-)Gesellschaft sprechen kann (105). Es geht ihm um die Frage, wie es angesichts dieser Prozesse um den Zusammenhalt und die LeistungsfĂ€higkeit der (GroĂ-)StĂ€dte bestellt ist, wie das âRecht auf Differenzâ und urbane Partizipation postuliert, respektiert und anerkannt werden kann. Eine vergleichende Analyse zeigt nach Bukow, dass in Frankreich âSozialrassismenâ, in âDeutschland eher âKulturrassismusâ zur ErklĂ€rung von âStadtproblemenâ herangezogen werden. In beiden LĂ€ndern werden in einer politisch-ökonomischen Perspektive âunnĂŒtze-â (proletarische) und ânĂŒtzliche Einwandererâ (Ărzte, Ingenieure) unterschieden. Bukow erinnert daran, dass das Ruhrgebiet quasi durch (Industrialisierung und) Einwanderung entstand und heute eher Probleme mit der Entindustrialisierung, nicht mit Einwanderung hat, denn die durch Migration entstandene âneue MobilitĂ€t und die neue DiversitĂ€tâ sind zum âkonstruktiven Merkmal moderner Stadtgesellschaftenâ avanciert (111). Der Autor sieht ein im Weberschen Sinne âzweckrationalesâ VerhĂ€ltnis âzwischen MobilitĂ€t und DiversitĂ€t einerseits und der Stadtgesellschaft andererseitsâ (113), welches durch âGlobalisierungâ, âneue Medienâ und âPostmoderneâ mit-ausgelöst wurde. Den âAlltag der Stadtgesellschaftâ versteht Bukow als âlokalen FuĂabdruck einer globalisierten Alltagswirklichkeitâ, als âgelebte, informelle Form der Inklusionâ (117). Seiner Meinung nach geht es darum, dass MobilitĂ€t und DiversitĂ€t als âimmanenter Bestandteil der eigenen Wirklichkeitskonstruktion betrachtet werdenâ (119), d.h. fĂŒr GroĂstĂ€dte in EinwanderungslĂ€ndern normal sind. Folglich wĂ€re eine (sozialpolitische) Neuordnung angesagt, in der es um âmehr Gerechtigkeitâ, den Abbau der âintersektionellen Aufsplitterungâ und um ein âSelbstverstĂ€ndnis der Stadtgesellschaft als einer "inclusive city"â geht (120f).
Zuletzt will ich mich dem Aufsatz des Mit-Herausgebers Marc Hill zum Thema âPostmigrantische Alltagspraxen von Jugendlichenâ (171ff) widmen. Der Autor ĂŒbernimmt die Daten (biographische Interviews, N = 30, Gruppendiskussionen) seiner qualitativen Dissertationsstudie zu âLebensentwĂŒrfe[n] von Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus marginalisierten Stadtviertelnâ (in Klagenfurt / KĂ€rnten). Ihre Erfahrungen, Reaktionen, Lebens- und Bildungsstrategien nennt er nun âpostmigrantische Alltagspraxenâ und interpretiert sie als solche. Mittlerweile sind in Einwanderungsgesellschaften Biographien globalisiert und Orte transnational. Andererseits bestimmt immer noch, so Marc Hill, ein âethnisch-kulturell-religiös-territoriales Differenzdenkenâ (âWir und die Anderenâ, Einheimische und AuslĂ€nder) den (alltĂ€glich-medialen und / oder auch akademischen?) Migrationsdiskurs. Hill beschreibt fĂŒnf âLebensentwĂŒrfe von Jugendlichenâ (180ff), die dokumentieren, wie ironisch und kreativ, selbstbewusst und kritisch-reflexiv die jungen Leute sind, aber auch, welche diskriminierenden Erfahrungen der Nicht-Zugehörigkeit sie machen und welche Bedeutung die Familie fĂŒr sie hat. Dadurch entsteht ein âanderer Blick auf Migrationâ. Die subjektiven Interpretationen der Jugendlichen bezeichnet Hill als postmigrantische Alltagspraxen, die wiederum âBestandteil von urbanen Bildungsprozessenâ sind (190).
Zusammenfassend kann ich den Anspruch bzw. die Programmatik des Readers nur begrĂŒĂen, nĂ€mlich: einen anderen Blick, eine andere (theoretische) Perspektive auf Migration und das Postmigrantische (âNach der Migrationâ) zu werfen und dabei die eindimensionalen ânationalstaatlichen Deutungenâ in Frage zu stellen, EinwandererInnen als Subjekte und GeschichtenerzĂ€hlerInnen ernst zu nehmen und deren Interpretationen zu Wort kommen zu lassen (Anwaltsforschung!) sowie die Migrations- und Integrationsforschung in eine herrschaftskritische Gesellschaftstheorie zu ĂŒberfĂŒhren und Gesellschaftstheorie zu migrantisieren. Allerdings sehe ich den âhegemonialen Diskursâ nicht so starr und homogen in binĂ€ren Kategorien und Dualismen verhaftet. Ich denke, wir sind da schon weiter, und es lohnt nicht, einen neuen Dualismus bzw. eine neue Differenz zwischen traditionaler (herrschender) und kritischer (radikal anderer) Migrationsforschung zu konstruieren, was nur Ab- und schlieĂlich Aus-Grenzung zur Folge hat (âWir und die Anderenâ!). Max Horkheimer hat seinen programmatischen Artikel âTraditionelle und kritische Theorieâ zu dieser m.E. mittlerweile ĂŒberholten Polarisierung bereits 1927 (!) verfasst [4].
Problematisch ist m.E., dass die âneue Perspektiveâ nahezu ausschlieĂlich die âGastarbeiterInnenâ und ihre Nachkommen ins Blickfeld nimmt, wodurch andere EinwandererInnengruppen âmarginalisiertâ werden. Migration war nicht nur gestern (GastarbeiterInnen); sie findet kontinuierlich (FlĂŒchtende) statt. Das âradikal neue Denkenâ ist zudem zu eng und zu sehr auf (westdeutsche!) GroĂstĂ€dte fokussiert. Deutschland besteht nicht nur aus Köln, MĂŒnchen oder Frankfurt, und Ăsterreich ist mehr als Wien und Klagenfurt. Ich schreibe das aus der Perspektive des ostdeutschen NeubĂŒrgers, der in Sachsen-Anhalt auf dem strukturschwachen Lande wohnt! Was ist mit der Provinz?
Zur Marginalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen trĂ€gt auch bei, dass Yildiz das âPostmigrantische [âŠ] als ein[en] Kampfbegriff gegen "Migrantisierung" und Marginalisierung von Menschenâ begreift (22). In dieser Begrifflichkeit schwingt der Terminus âMigrationâ weiter vehement mit. Es erscheint mir nachhaltiger fĂŒr ein âradikal neues Denkenâ oder eine âkritische Migrationsforschungâ, wenn man in einer Einwanderungsgesellschaft auf Begriffe wie âMigrationâ, âKulturâ, âIntegrationâ oder âIdentitĂ€tâ, auch in ihren Zusammensetzungen (âMigrationshintergrundâ, âhybride IdentitĂ€tâ, âinter- oder multikulturellâ etc.), verzichtet. Ansonsten bleibt man dem binĂ€ren (tendenziell rassistischen) Denken verhaftet.
Konsequenterweise mĂŒsste in diesem kritischen Entwurf und Kontext auch die empirische Variante bzw. die andere, die methodische Seite der Medaille (Kritische postmigrantische Forschung) angesprochen werden. Zu denken ist wohl an âoral historyâ oder narrative Biographieforschung und Gruppendiskussionen, wodurch auch deutlich wird, dass an der âpostmigrantischen Perspektiveâ kaum etwas âradikal neuâ ist. Ein groĂer Teil der neueren, sich ebenfalls âkritischâ und gesellschafts- bzw. machttheoretisch nennenden Migrationsforschung bleibt ausgeblendet [z.B. 5 und 6]. Ăberhaupt fĂ€llt mir auf, dass Ă€ltere Studien ignoriert werden, obwohl bereits in den 70er Jahren AnfĂ€nge eine kritischen makro- und gesellschaftstheoretischen Migrations- bzw. âGastarbeiterforschungâ, auch in postmigrantischer (!) Perspektive [vgl. exemplarisch 7] existierten. Migrationsforschung in Deutschland gibt es seit knapp 50 Jahren.
So finde ich viele AnsĂ€tze und Forderungen Ă€uĂerst sympathisch und theoretisch angemessen und notwendig, z.B. âgesellschaftliche VerhĂ€ltnisse neu zu denkenâ, die âpostmigrantische Perspektiveâ einzunehmen (können dies auch âEinheimischeâ?), die gĂ€ngige Terminologie zu ĂŒberdenken und zu modifizieren (âKulturâ, âIntegrationâ, âIdentitĂ€tâ, âMigrationshintergrundâ usw.). Es fehlt mir bisher allerdings die Umsetzung. Mir fehlen zumindest thesenartige gesellschaftstheoretische oder konkrete herrschafts- und machtkritische ErgĂ€nzungen mit Blick auf die Frage âIn welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?â [vgl. dazu 1]. Und wo lassen sich, bezogen auf das Postulat einer Migrationsforschung als kritische Gesellschaftstheorie, im Reader elaborierte AnsĂ€tze dazu erkennen? Ich bin, bis auf Hinweise, Postulierungen, starke Termini und brillante Formulierungen (vgl. Römhild) nicht fĂŒndig geworden. Was sind die empirisch-methodischen Konsequenzen? Was bedeutet die neue Programmatik fĂŒr die konkrete empirische Forschung? Eine Methodendiskussion innerhalb der âpostmigrantischen Perspektiveâ bzw. ein eigener Beitrag dazu fehlt gĂ€nzlich!
Ich hĂ€tte mir auch ein eher alltagssprachlich und konkret formuliertes Fazit oder ResĂŒmee der Herausgeber gewĂŒnscht, das sich auch programmatisch an Kreise der Politik und Medien, sowie an die Ăffentlichkeit richtet. Wozu sonst eine kritische postmigrantische Forschung? Wer ist AdressatIn dieser Forschung? Die kritische Sozialwissenschaft scheint sich von der (Einwanderungs-)Gesellschaft und ihrer RealitĂ€t und Entwicklung mehr oder weniger abgekoppelt zu haben bzw. wurde von ihr exkludiert und betreibt so ihr eigenes GeschĂ€ft. Es geht aber bei diesem Thema um die vielzitierte âMitte der Gesellschaftâ, das âBĂŒrgerInnenbewusstseinâ.
Also warte ich neugierig auf die Fortsetzung des Projektes âpostmigrantische Gesellschaftstheorieâ. Liebe Kolleginnen und Kollegen: Es gibt noch viel zu tun â packt es an!
[1] Pongs, A.: In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? 2 BĂ€nde. MĂŒnchen: Dilemma Verlag 2000.
[2] Griese, H. M. (Hrsg.): Der glÀserne Fremde. Bilanz und Kritik der Gastarbeiterforschung und der AuslÀnderpÀdagogik. Opladen: Leske 1984.
[3]: Griese, H. M.: Kritik der âInterkulturellen PĂ€dagogikâ. Essays gegen Kulturalisierung, Ethnisierung, Entpolitisierung und einen latenten Rassismus. MĂŒnster: LIT-Verlag 2002.
[4] Horkheimer, M.: Traditionelle und kritische Theorie. In: Zeitschrift fĂŒr Sozialforschung 1937, 245-294.
[5] Mecheril, P. u.a. (Hrsg.): Migrationsforschung als Kritik? Konturen einer Forschungsperspektive. Wiesbaden: VS Verlag fĂŒr Sozialwissenschaften 2013.
[6] Mecheril, P. u.a. (Hrsg.): Migrationsforschung als Kritik? SpielrĂ€ume kritischer Migrationsforschung. Wiesbaden: VS Verlag fĂŒr Sozialwissenschaften 2013.
[7] Nikolinakos, M.: Politische Ăkonomie der Gastarbeiterfrage. Migration und Kapitalismus. Reinbek: Rowohlt 1973.
