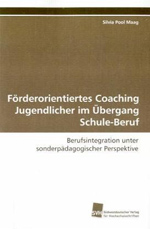 âDer Pädagoge machte Jagd auf die Personen, die sich weigerten, die von ihm für normal gehaltenen Wege zu benutzenâ (6) â so zitiert Silvia Pool Maag, wissenschaftliche Mitarbeiterin am ehemaligen Institut für Sonderpädagogik, das mit dem ebenso ehemaligen Pädagogischen Institut das neue Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich bildet, Célestin Freinet im Vorwort zu ihrer Dissertation über Jugendliche, Coaching und den Ãbergang von der Schule in den Beruf. Das Zitat bildet gleichsam den metaphorischen Ausgangspunkt ihrer mehrjährigen wissenschaftlichen Arbeit, in und mit der sie einen Weg zwischen Fragmenten empirischer Sozialforschung und Theorien mittlerer Reichweite gesucht und gefunden hat: Bildungs- und sozialpolitische Akteure machen Jagd auf Jugendliche, die durch das Bildungs- und Beschäftigungssystem der Gegenwart in anomische Situationen manövriert wurden â und vergeben Forschungsaufträge, um zu klären, wie das zu klären sei.
âDer Pädagoge machte Jagd auf die Personen, die sich weigerten, die von ihm für normal gehaltenen Wege zu benutzenâ (6) â so zitiert Silvia Pool Maag, wissenschaftliche Mitarbeiterin am ehemaligen Institut für Sonderpädagogik, das mit dem ebenso ehemaligen Pädagogischen Institut das neue Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich bildet, Célestin Freinet im Vorwort zu ihrer Dissertation über Jugendliche, Coaching und den Ãbergang von der Schule in den Beruf. Das Zitat bildet gleichsam den metaphorischen Ausgangspunkt ihrer mehrjährigen wissenschaftlichen Arbeit, in und mit der sie einen Weg zwischen Fragmenten empirischer Sozialforschung und Theorien mittlerer Reichweite gesucht und gefunden hat: Bildungs- und sozialpolitische Akteure machen Jagd auf Jugendliche, die durch das Bildungs- und Beschäftigungssystem der Gegenwart in anomische Situationen manövriert wurden â und vergeben Forschungsaufträge, um zu klären, wie das zu klären sei.
Eines der vielleicht hervorragendsten Merkmale von Pool Maags Arbeit besteht darin, dass sie sich innerlich vorbehaltlos hinter die schwierige Aufgabe von betroffenen Jugendlichen und die sie begleitenden Lehrpersonen und Coaches stellt und dass sie zugleich versucht, alle verfügbaren Wissensressourcen, die sie in der Rolle als Wissenschafterin ausfindig machen konnte und die zur Bewältigung dieser Aufgabe nützlich sein könnten, beizuziehen. Die Arbeit integriert sonder-, berufs- und schulpädagogisches Wissen, empirische Untersuchungen über soziale Benachteiligung und Transitionsprozesse, Studien zur Bildungs- und Arbeitsmarktforschung sowie Konzepte und, soweit vorfindbar, empirische Arbeiten über Coachingprozesse. Heterogenitätsrelevante Aspekte wie Behinderung, Geschlecht oder Herkunft werden ebenso thematisiert. Perspektivisch integriert die Autorin die Befunde aus der Literatur über einen gesundheitspsychologischen und am Konstrukt des Lebenslaufs orientierten Fokus. Weil sie diesen Fokus auf dem Hintergrund der Exklusionsthematik wählt, gelingt es ihr, die ökosystemischen Bedingungen von Individuation mitzuberücksichtigen â auch wenn ihr die personalen Dimensionen insgesamt näher bleiben.
Der empirische Teil der Arbeit folgt einem formativen Evaluationsdesign im quantitativen und qualitativen Paradigma. Da es sich dabei um einen Begleitprozess zur Entwicklung einer Coachingpraxis in der Berufsbildung handelt, in welchem eine überschaubare Anzahl Personen involviert waren, hätte man sich ein konsequenter qualitativ ausgerichtetes Vorgehen gewünscht, das vermutlich noch besser in der Lage gewesen wäre, die Tiefendimensionen der Erfahrungen in diesen Systembrüchen zur Sprache zu bringen.
Konzeptionell zielt Pool Maag mit ihrer Arbeit auf eine Coaching-Rahmentheorie, die sie sonderpädagogisch einbettet. âSonderpädagogischâ heisst hier: Bezug nehmend auf die Aufgabe der Exklusionsvermeidung (Vera Moser) im Erziehungs- und Beschäftigungssystem und verbunden mit dem Anspruch auf Bildung. Die Begriffswahl zwischen Konkretisierung und inhaltlicher Unterbestimmtheit â âförderorientiertes Coachingâ â dokumentiert, wie schwierig es ist, die Qualität der Problemstellung und der Arbeit zu beschreiben, der die Autorin mit ihrer Studie sorgfältig nachgegangen ist. In diesem Sinne ist die Dissertation nicht nur in Bezug auf ihren unmittelbaren Gegenstand interessant zu lesen, sondern sie ist auch als Fall von Wissensproduktion, auf dem Hintergrund der Frage wie heterogene Wissensbestände aufeinander bezogen werden können, anregend.
