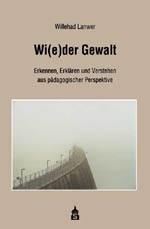 Willehad Lanwer ist Professor an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt, Studiengang Inclusive Education. Er beschäftigt sich in Forschung und Lehre u.a. mit selbstverletzenden Handlungen bei Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie mit Fragen der Integration und Exklusion von Menschen mit Behinderung in Bildung und Gesellschaft. Dieser Hintergrund erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich im Kontext der Gewaltforschung: Die medial dominierte Debatte um Jugendgewalt steht beispielhaft für die Konfiguration von Gewalt als isoliertes Thema, das isolierte Expertisen mit sich bringt: Jugendgewalt, Männergewalt, Gewalt gegen Kinder, häusliche Gewalt – immer scheint es um ganz verschiedene Dinge zu gehen, deren Zusammenhang und deren Abhängigkeiten jeweils aufwändig rekonstruiert werden müssen, was insgesamt auf einen Verlust an gesellschaftstheoretischer Modellierung gerade in der Erziehungswissenschaft hindeutet. Militärische Gewalt, pädagogische Gewalt und selbstverletzendes Verhalten sind nicht dasselbe, aber es ist weiterführend, Zusammenhänge zu postulieren und von hier aus Modellierungen vorzunehmen. Lanwer versammelt in seiner Monographie rezente Linien der Theoriebildung – kritische Theorie, Tätigkeitstheorie, die Arbeiten um Bourdieu und andere – und fragt nach ihrem Beitrag zum Erkennen, Erklären und Verstehen von Gewalt. Die Arbeit ist nicht nur eine wider die Gewalt, sondern auch wider das Vergessen von theoretischen Gesichtspunkten, welche für die Überwindung von Gewalt eine wichtige Rolle spielen. Ausgelöst wurde die Arbeit durch die Auseinandersetzung um die sogenannte Konfrontative Pädagogik, womit weit mehr als ein Methodenstreit gemeint ist: Nach Lanwer kann diese „nicht losgelöst von der neoliberalen Globalisierung betrachtet werden“ (133). Damit ist der Radius der Arbeit skizziert: Es geht um eine methodologisch geführte Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Gewalt und deren demokratie- und professionstheoretische Konsequenzen.
Willehad Lanwer ist Professor an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt, Studiengang Inclusive Education. Er beschäftigt sich in Forschung und Lehre u.a. mit selbstverletzenden Handlungen bei Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie mit Fragen der Integration und Exklusion von Menschen mit Behinderung in Bildung und Gesellschaft. Dieser Hintergrund erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich im Kontext der Gewaltforschung: Die medial dominierte Debatte um Jugendgewalt steht beispielhaft für die Konfiguration von Gewalt als isoliertes Thema, das isolierte Expertisen mit sich bringt: Jugendgewalt, Männergewalt, Gewalt gegen Kinder, häusliche Gewalt – immer scheint es um ganz verschiedene Dinge zu gehen, deren Zusammenhang und deren Abhängigkeiten jeweils aufwändig rekonstruiert werden müssen, was insgesamt auf einen Verlust an gesellschaftstheoretischer Modellierung gerade in der Erziehungswissenschaft hindeutet. Militärische Gewalt, pädagogische Gewalt und selbstverletzendes Verhalten sind nicht dasselbe, aber es ist weiterführend, Zusammenhänge zu postulieren und von hier aus Modellierungen vorzunehmen. Lanwer versammelt in seiner Monographie rezente Linien der Theoriebildung – kritische Theorie, Tätigkeitstheorie, die Arbeiten um Bourdieu und andere – und fragt nach ihrem Beitrag zum Erkennen, Erklären und Verstehen von Gewalt. Die Arbeit ist nicht nur eine wider die Gewalt, sondern auch wider das Vergessen von theoretischen Gesichtspunkten, welche für die Überwindung von Gewalt eine wichtige Rolle spielen. Ausgelöst wurde die Arbeit durch die Auseinandersetzung um die sogenannte Konfrontative Pädagogik, womit weit mehr als ein Methodenstreit gemeint ist: Nach Lanwer kann diese „nicht losgelöst von der neoliberalen Globalisierung betrachtet werden“ (133). Damit ist der Radius der Arbeit skizziert: Es geht um eine methodologisch geführte Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Gewalt und deren demokratie- und professionstheoretische Konsequenzen.
Nach einem einführenden Teil und vor den Schlussteilen gliedert Lanwer seine Arbeit in vier große Kapitel: Dialektik, Tätigkeitstheorie, sozialwissenschaftliche Bezugspunkte und (kritische) Pädagogik. Er definiert einleitend: „Gewalt basiert auf Interessen- und Bedürfnisgegensätzen, die sich zu einem Widerspruch verdichten, der zu Konflikten führt“ (8). Er rückt ausgehend von diesem Verständnis und im Sinne einer Problemexposition die konfrontative Pädagogik ins analytische Licht: Lanwer weist dieser ein verkürztes Gewaltverständnis nach, das dazu führt, dass Gewalt als notwendiges Mittel der Pädagogik erscheint. Lanwer macht jedoch geltend, dass „die Art und Weise wie eine pädagogische Fragestellung erkannt, erklärt und verstanden wird (...) den Ausgangspunkt [bildet] von dem aus die Planung und Umsetzung des konkreten pädagogischen Handelns erfolgt“ (18). Der Skandalisierung von Gewalt mit dem Effekt der impliziten oder expliziten Legitimierung repressiver Maßnahmen setzt er eine biographieorientierte, entwicklungsbezogene Sichtweise entgegen: Gewalt erscheint so durchgehend als „Mittel zur Lösung von Konflikten, aufgrund sich widersprechender Interessen in dem Geflecht der Reproduktion von Lebensbedingungen in den Feldern des sozialen Raums“ (25).
Im Teil über die Dialektik führt Lanwer in die Analyse von sozialen Verhältnissen ein. Der Grundgedanke ist, dass eine analytisch gewählte Einheit (eine Person, eine Handlung, ein Verlauf) so zu wählen ist, dass sie nicht nur als Zustand, sondern in ihren Wechselwirkungen sichtbar wird. In der Wechselwirkung werden beobachtete Einheiten in ihrem Werden rekonstruierbar und damit auch in Widersprüchen und in unterschiedlichen Formen der Aufhebung von Widersprüchen. An dieser Stelle wird die Kategorie der Tätigkeit eingeführt, die Lanwer als „Vermittlungskategorie des Menschen zu seiner Wirklichkeit“ versteht (55). Die Kategorie der Tätigkeit, so Lanwer mit Bezug auf Leontjew, umfasst „alle menschlichen Betätigungsweisen, alle Formen von Praxis in denen Menschen im Verhältnis zu ihrer Wirklichkeit tätig werden“ (ebd.). Gewalt erscheint somit als Mittel und Ergebnis in subjektiven und kollektiven Aneignungsprozessen, also als Dimension des Austauschens von Gütern und Zeichen in historisch verkörperten Verhältnissen. Im Kapitel über die sozialwissenschaftlichen Grundlagen erweitert Lanwer das Spektrum des Lesens von Gewalt indem er einige klassische Positionen referiert und mit diesen den begrifflichen Raum von Gewalt und Macht auslotet (Weber, Foucault, Bourdieu u.a.). Von hier aus erfolgt die Rückkehr in die Pädagogik und eine erneute Auseinandersetzung mit der „ideologischen Überfrachtung“ (126), der „double bind Situation“ (128), der Gender-Problematik und „antidemokratischen“ (134) Praxen der Konfrontativen Pädagogik. Ihr gegenüber formuliert Lanwer eine demokratie- und professionstheoretisch reflektierte Konzeption von Pädagogik: „Mithin geht es für die pädagogisch Handelnden um die Aneignung von reflexivem Wissen, um die eigene Position im sozialen und historischen Kontext bestimmen zu können – im Sinne der Gestaltung von Lern- und Lebensfelder für die Kinder und Jugendlichen“ (135). Er diskutiert anschließend Positionen der kritischen Pädagogik (Gramsci, Heydorn) und verbindet sie mit Konzepten der materialistischen Behindertenpädagogik (Feuser, Jantzen).
In den Schlusskapiteln fokussiert Lanwer auf die Zielsetzung der Überwindung von Gewalt, die er sich ebenso politisch wie pädagogisch als Bildungsprozess vorstellt und daran erinnert, dass die Bedeutung von Bildungssystemen moderner Gesellschaften auch und vor allem darin liegt, zur „demokratische(n) Strukturbildung des sozialen Raums“ beizutragen (196). Damit findet die Monographie ihren Abschluss. Mit ihr liegt ein Werk vor, das zwar anspruchsvoll zu lesen, aber zugleich darum bemüht ist, Denklinien zu vermitteln und exemplarisch zu erläutern. Im Sinne eines Ausblicks wäre zu wünschen, dass die methodologisch orientierte Studie auch im Kontext der empirischen Gewalt- und Sozialisationsforschung, aber auch für klinische Studien rezipiert wird und so dazu beiträgt, im Alltag des Denkens über Gewalt andere Akzente zu setzen.
