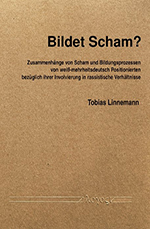 Die Studie âBildet Scham? ZusammenhĂ€nge von Scham und Bildungsprozessen von weiĂ-mehrheitsdeutsch [1] Positionierten bezĂŒglich ihrer Involvierung in rassistische VerhĂ€ltnisseâ von Tobias Linnemann widmet sich der Auseinandersetzung von PĂ€dagog:innen mit der eigenen Verstrickung in Rassismus. Linnemann geht davon aus, dass âin den Prozessen, in denen eine Auseinandersetzung mit Rassismus, WeiĂsein, und Privilegien stattfindet, Scham, die Vermeidung, Abwehr und Verarbeitung von Scham sowie Angst vor Scham eine Rolle spielen könnenâ (14). Der ambivalenten Rolle von Scham in rassismuskritischen Bildungsprozessen wird mit der Analyse von biographisch-narrativen Interviews mit weiĂ-mehrheitsdeutsch positionierten Menschen nachgespĂŒrt, die in diversen pĂ€dagogischen Feldern arbeiten. Der Autor reflektiert die Ergebnisse seiner Studie daher auch fĂŒr das Feld der politischen Bildung, in dem er sich selbst verortet.
Die Studie âBildet Scham? ZusammenhĂ€nge von Scham und Bildungsprozessen von weiĂ-mehrheitsdeutsch [1] Positionierten bezĂŒglich ihrer Involvierung in rassistische VerhĂ€ltnisseâ von Tobias Linnemann widmet sich der Auseinandersetzung von PĂ€dagog:innen mit der eigenen Verstrickung in Rassismus. Linnemann geht davon aus, dass âin den Prozessen, in denen eine Auseinandersetzung mit Rassismus, WeiĂsein, und Privilegien stattfindet, Scham, die Vermeidung, Abwehr und Verarbeitung von Scham sowie Angst vor Scham eine Rolle spielen könnenâ (14). Der ambivalenten Rolle von Scham in rassismuskritischen Bildungsprozessen wird mit der Analyse von biographisch-narrativen Interviews mit weiĂ-mehrheitsdeutsch positionierten Menschen nachgespĂŒrt, die in diversen pĂ€dagogischen Feldern arbeiten. Der Autor reflektiert die Ergebnisse seiner Studie daher auch fĂŒr das Feld der politischen Bildung, in dem er sich selbst verortet.
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, fĂŒnf Kapitel und einen Schlussteil. Im ersten Kapitel wird der rassismustheoretische Rahmen der Studie (17) kenntnisreich ausgebreitet. Mit Peggy Piesche [2] verweist Linnemann zunĂ€chst auf die jahrhundertealte Tradition der Beobachtung und Kritik von weiĂer Hegemonie durch Schwarze Menschen und People of Color (18). Diese Wissensarchive sind fĂŒr Linnemann die Grundlage (10) fĂŒr weiĂe rassismuskritische Positions- und Selbstreflexionsprozesse. Die Analyse und Theoretisierung dieser Prozesse werden als Gegenstand der vorliegenden Studie formuliert. Der Autor arbeitet hierfĂŒr zunĂ€chst die deutsch- und englischsprachige wissenschaftliche Debatte zu Rassismus und WeiĂsein auf. Im deutschen Kontext, so resĂŒmiert Linnemann, sei Rassismus stark durch Tabuisierung geprĂ€gt (22). Ferner findet sich in dem Kapitel eine differenzierte Auseinandersetzung mit den âUneindeutigkeiten von WeiĂseinâ und ein âPlĂ€doyer fĂŒr Ambivalenzenâ (57). Dabei geht es Linnemann nicht um eine essentialisierende Erforschung von weiĂen Menschen, sondern um die Erforschung einer Gruppe, die er durch die âAbwesenheit von persönlichen Rassismus- und Antisemitismuserfahrungenâ (59f.) definiert.
Im Anschluss daran widmet sich das zweite Kapitel der Scham. Tobias Linnemann definiert Scham mit Alfred SchĂ€fer und Christiane Thompson als âReaktion auf das scheiternde VerhĂ€ltnis des Individuums zu seinem idealen Selbstbildâ [3] (100) und verbindet scham- und rassismustheoretische Erkenntnisse auf eine ĂŒberzeugende Weise. Er arbeitet mit Grada Kilomba [4] heraus, dass âweiĂen Subjekten [âŠ] strukturell ein SelbstverstĂ€ndnis nahegelegt [wird], sich souverĂ€n zu wĂ€hnen und als Teil einer unmarkierten weiĂen Norm auĂerhalb rassistischer VerhĂ€ltnisseâ (109) zu verstehen. Diese Form der Subjektivierung erschwert oder verunmöglicht Selbst- und PositionsreflexivitĂ€t. Daher wird die Wichtigkeit des beobachtenden Anderen bei der Reflexion der eigenen machtvollen sozialen Position hervorgehoben, der dazu verhelfen kann âeine andere als die gesellschaftlich dominante und individuell gewohnte Perspektive auf sich zu gewinnenâ (ebd.).
Im dritten Kapitel widmet sich Linnemann der Beschreibung seiner methodischen und methodologischen Vorgehensweise. Die Studie basiert auf qualitativen Interviewdaten, die durch âthemenzentrierte biographisch-narrative Interviewsâ (142) erzeugt wurden. Die sechs Interviews wurden mit Personen gefĂŒhrt, die sich als weiĂ-mehrheitsdeutsch positionieren, einen akademischen Hintergrund haben und sich schon lĂ€ngere Zeit mit Rassismus und WeiĂsein beschĂ€ftigen (145). Die Interviewpartner:innen wurden durch Organisationen vermittelt, die sich politisch oder pĂ€dagogisch mit den Themen Rassismus, WeiĂsein oder (Post-)Kolonialismusâ (145) auseinandersetzen. Die Auswertung der Daten basiert auf dem Konzept der âModellierungâ (150).
In Kapitel vier arbeitet Linnemann anhand von zwei detaillierten Fallrekonstruktionen âempirische Dimensionen von Scham weiĂ Positionierterâ (173) auf. Der Autor rekonstruiert zunĂ€chst die vorgenommenen Positionierungen, die er als SelbstentwĂŒrfe interpretiert und âim Hinblick auf den Gehalt bezĂŒglich idealer Selbstbilderâ (175) analysiert. Diesen idealen Selbstbildern, wie âweltoffenâ (175) und âkritischâ (235), stellt er erzĂ€hlte Momente der Diskrepanz gegenĂŒber, die sich durch âscheiternde Ăbereinstimmung von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmungâ (196) zeigen. Die Analyse von Linnemann illustriert, dass entgegen des eigenen idealen Selbstbildes, die zwei interviewten Personen im erzĂ€hlerischen RĂŒckblick âpaternalistischâ (196), âgrenzĂŒberschreitendâ (199), âĂŒberheblichâ (204), mit ârassismusrelevanten Wahrnehmungen und Phantasienâ (241) sowie âmachtvoll und kolonialâ (244) agierten. Diese dominanten und rassismusrelevanten Phantasien und Handlungsweisen wurden hĂ€ufig erst durch einschneidende und schamvolle Erfahrungen wie einem Kontaktabbruch von rassismuserfahrenen Personen (200) oder in nachgelagerten theorieinspirierten Reflexionsprozessen als problematisch verstanden und lösten krisenhafte Situationen aus.
Im fĂŒnften Kapitel nimmt Linnemann den Versuch einer âSystematisierung und Retheoretisierung von Scham weiĂ Positionierterâ (325) vor. Er unterscheidet zwei Varianten von Scham, die er einerseits âscheiternde Ăbereinstimmung von idealem Selbstbild und Handelnâ (326) und andererseits âscheiternde Ăbereinstimmung von Selbstkonzept und Wahrnehmung durch Andereâ (336) nennt. Bei ersterer Variante geht es um Scham, die entsteht, wenn es etwa um âeigenes rassistisches oder ĂŒberhebliches Handelnâ (327), ârassistische Wahrnehmungâ (329) und âNichthandelnâ (332) in konkreten rassistischen Situationen geht. Dies wird hĂ€ufig erst im Nachgang der Situation bemerkt und schamvoll reflektiert. Den empirischen Bezug findet Linnemann bspw. in Metaphern, wie âim Boden versinkenâ (103) oder in Vorhaben aus Scham, âkaum noch ins Ausland zu reisenâ (287). In dieser Variante von Scham wird gegen die âmoralische normative Orientierung verstoĂenâ (335), wodurch âeine Ăbereinstimmung mit dem idealen Selbstbild scheitertâ (335). Die zweite Schamvariante ist âunabhĂ€ngig von einem Bezug auf Handlungen oder Nichthandlungenâ (336). Hier geht es um die Erfahrung, dass und wie die eigene privilegierte Subjektposition und das eigene, auch rassistisch unterminierte Selbstkonzept aus einer rassismuserfahrenen Position betrachtet wird. Der damit beginnende Perspektivwechsel, âals weiĂ Positionierte im realen oder medial vermittelten Blick von Schwarz oder of Color Positionierten anders sichtbarâ (336) zu werden, eröffnet mit Grada Kilomba wichtige Fragen: âWho am I? How do others perceive me? And what do I represent to them?â [4].
Das sechste Kapitel der Studie dient zunĂ€chst der allgemeinen Theoretisierung von Scham, Bildung und Bildungsprozessen, ehe Linnemann in einem sehr lesenswerten Ausblick ĂŒber âScham und politische Bildung zu Rassismus und WeiĂseinâ (430) reflektiert. Er spricht sich fĂŒr eine politische Bildung aus, die âgezielte BeschĂ€mungâ vermeiden âund unbeabsichtigtes Schamerlebnis berĂŒcksichtigen kannâ (431). FĂŒr Linnemann liegt in der Erfahrung von Scham von weiĂ Positionierten âdas Potential von transformativen Bildungsprozessenâ (431) â ohne diese jedoch bewusst zu beschĂ€men. Um den konstruktiven Charakter von Scham zu ermöglichen, empfiehlt Linnemann fĂŒr Bildungssettings einen Rahmen, der âdie Akzeptanz, Anerkennung, Reflexion und Begleitung von aktuellem und vergangenen Schamerleben möglich machtâ (433). Rassismuskritische politische Bildung dĂŒrfe sich aber nicht darauf beschrĂ€nken, RĂ€ume fĂŒr weiĂe Scham zu schaffen. Die anfĂ€ngliche BeschĂ€mung mĂŒsse mit Spivak [5] dazu fĂŒhren, die Komplizenschaft mit Rassismus anzuerkennen. Dadurch könnten weiĂe Menschen ânicht so viel Kraft darauf verwenden, sich fĂŒr ihr WeiĂsein, rassistische Gedanken oder Handlungen zu schĂ€men oder diese Scham abzuwehren, sondern [âŠ] die Kraft fĂŒr proaktives Handeln auf[zu]wendenâ (444).
Tobias Linnemann sieht seine privilegierte Sprecherposition als Teil seiner AusfĂŒhrungen und Analysen. Im Text werden persönliche Augenblicke geteilt, wie etwa eigene Zweifel bezĂŒglich der Forschung aus seiner Positionierung heraus (60), oder eigene Erfahrungen mit Privilegien und WeiĂsein (99). Diese Herangehensweise zeigt die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand. Es ist ein besonderes Verdienst der Arbeit, eine gröĂere KomplexitĂ€t in die Diskussion um weiĂe Scham gebracht zu haben. Linnemanns Untersuchung kann zeigen, dass Scham eben nicht nur aus einem moralischen Dilemma entsteht, sondern mit dem privilegiert positionierten Subjekt selbst zu tun hat. Subjektpositionen und Selbstkonzeptionen können nur begrenzt vom Subjekt selbst reflektiert und in noch geringerem AusmaĂ verĂ€ndert werden. Dies fĂŒhrt mit Linnemann zur Notwendigkeit der Vorstellung eines ârelativierten und reflexiven Handlungsvermögen[s]â (449). Gesellschaftliche VerhĂ€ltnisse können also nicht einfach verlassen werden. Die Involvierung macht uns aber auch nicht handlungsunfĂ€hig. Die Studie bietet sowohl fĂŒr die Wissenschaft als auch fĂŒr die Praxis politischer Bildung wichtige Erkenntnisse.
[1] WeiĂ und WeiĂsein werden als machtvolle soziale Konstruktionen âmit realen, nicht selten gewaltvollen RealitĂ€tenâ [2] verstanden.
[2] Piesche, P. (2009). Das Ding mit dem Subjekt, oder: Wem gehört die kritische WeiĂseinsforschung? In M. M. Eggers, G. Kilomba, P. Piesche & S. Arndt (Hrsg.), Mythen, Masken und Subjekte: Kritische WeiĂseinsforschung in Deutschland (S.14â17). Unrast.
[3] SchĂ€fer, A., & Thompson, C. (2009). Scham: Eine EinfĂŒhrung. Schöningh.
[4] Kilomba, G. (2008). Plantation Memories. Unrast.
[5] Castro Varela, M., & Dhawan, N. (2015). Postkoloniale Theorie: Eine kritische EinfĂŒhrung. transcript.
