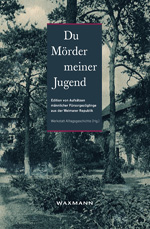

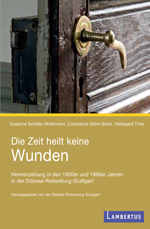 Bei der Geschichte der JugendfĂŒrsorge im Allgemeinen und der zwangsweisen Unterbringung von MinderjĂ€hrigen in Heimen der FĂŒrsorgeerziehung im Speziellen handelt es sich um ein, sowohl zeitgenössisch als auch in der historischen und historisch-pĂ€dagogischen Forschung, viel diskutiertes Themengebiet. Bereits in den 1980er und 1990er Jahren wurden wegweisende Studien zur Entstehung der FĂŒrsorgeerziehung im Kaiserreich und deren Entwicklung in der Weimarer Republik vorgelegt [1]. Eine erneute Debatte um die vielerorts hochproblematischen Erziehungsmethoden in der bundesdeutschen Heimerziehung entfachte das Buch des Spiegel-Reporters Peter Wensierski âSchlĂ€ge im Namen des Herrnâ 2006 [2]. Im Verlauf der Auseinandersetzungen ĂŒber das Thema wurde ein Runder Tisch Heimerziehung auf Bundesebene gebildet und letztlich ein Fonds Heimerziehung zugunsten der Betroffenen eingerichtet. Die im Folgenden besprochenen Publikationen setzen sich erneut mit der Geschichte der Kinder- und JugendfĂŒrsorge auseinander und knĂŒpfen zum Teil direkt an die aktuelle Debatte an.
Bei der Geschichte der JugendfĂŒrsorge im Allgemeinen und der zwangsweisen Unterbringung von MinderjĂ€hrigen in Heimen der FĂŒrsorgeerziehung im Speziellen handelt es sich um ein, sowohl zeitgenössisch als auch in der historischen und historisch-pĂ€dagogischen Forschung, viel diskutiertes Themengebiet. Bereits in den 1980er und 1990er Jahren wurden wegweisende Studien zur Entstehung der FĂŒrsorgeerziehung im Kaiserreich und deren Entwicklung in der Weimarer Republik vorgelegt [1]. Eine erneute Debatte um die vielerorts hochproblematischen Erziehungsmethoden in der bundesdeutschen Heimerziehung entfachte das Buch des Spiegel-Reporters Peter Wensierski âSchlĂ€ge im Namen des Herrnâ 2006 [2]. Im Verlauf der Auseinandersetzungen ĂŒber das Thema wurde ein Runder Tisch Heimerziehung auf Bundesebene gebildet und letztlich ein Fonds Heimerziehung zugunsten der Betroffenen eingerichtet. Die im Folgenden besprochenen Publikationen setzen sich erneut mit der Geschichte der Kinder- und JugendfĂŒrsorge auseinander und knĂŒpfen zum Teil direkt an die aktuelle Debatte an.
Bei dem von der âWerkstatt Alltagsgeschichteâ herausgegebenen Band handelt es sich um die kritische Edition von AufsĂ€tzen von FĂŒrsorgezöglingen. Sie entstanden Ende der 1920er Jahre auf Initiative des Publizisten und Theaterregisseurs Peter Martin Lampel wĂ€hrend dessen Hospitationszeit in der Berliner Erziehungsanstalt Struveshof. Seit Mitte der 1920er Jahre hatte eine ganze Reihe von Anstaltsrevolten und -skandalen fĂŒr öffentliches Aufsehen gesorgt; sie warfen Schlaglichter auf die MissstĂ€nde in den Einrichtungen der FĂŒrsorgeerziehung. Die von autoritĂ€ren wilhelminischen Traditionen geprĂ€gte Praxis der staatlichen Zwangserziehung war in eine offene Krise geraten. Lampel â Mitglied des sich als zeitkritisch begreifenden Literatur- und Theaterbetriebes â verarbeitete die AufsĂ€tze der Jugendlichen in geglĂ€tteter Form in seinem Aufsehen erregenden Buch âJungen in Notâ von 1928 und ein Jahr spĂ€ter in seinem vielgespielten TheaterstĂŒck âRevolte im Erziehungshausâ. Beide trugen zur Sensibilisierung der deutschen Ăffentlichkeit gegenĂŒber den vielerorts skandalösen ZustĂ€nden bei â interessanterweise eine Parallele zu den Recherchen und den sich anschlieĂenden kritischen Publikationen Ulrike Meinhofs ĂŒber die bundesdeutsche Heimerziehung ĂŒber 40 Jahre spĂ€ter [3].
Der vorliegende Band ist das beachtenswerte Ergebnis eines studentischen Editionsprojektes, das fachlich durch den Historiker Martin LĂŒcke begleitet wurde. Es findet sich zunĂ€chst eine ausfĂŒhrliche Einleitung mit formalen und inhaltlichen Ăberlegungen zur Quellenkritik und die Vorstellung des Quellenbestandes sowie der Editionsprinzipien. Der zweite Teil umfasst die insgesamt 60 AufsĂ€tze der 36 jugendlichen Autoren, die nach Textgattung und -inhalt gegliedert sind. Neben LebenslĂ€ufen und Erfahrungsberichten sind Gedichte und Fantasiegeschichten zu finden. DarĂŒber hinaus wurden auch einige Berichte und Beobachtungen Lampels aufgenommen.
Die edierten AufsĂ€tze selbst wurden jeweils mit einem textkritischen Apparat, in dem u.a. die verschiedenen Ăberarbeitungsstufen deutlich werden, und einem Sachapparat ausgestattet. Letzterer besticht durch die ErlĂ€uterung zeittypischer auch umgangssprachlicher Begriffe, aber auch durch Hinweise zu auftauchenden Orten, StraĂen und Regionen. Wiederkehrende Themen der AufsĂ€tze sind Kindheiten in prekĂ€ren sozialen VerhĂ€ltnissen, vielfĂ€ltige Gewalterfahrungen in verschiedenen Kontexten, so z.B. in der Herkunftsfamilie, in den Anstalten der FĂŒrsorgeerziehung aber auch im VerhĂ€ltnis der Jugendlichen untereinander. Die Erziehung in Struveshof wird nicht als unterstĂŒtzend bei der BewĂ€ltigung des eigenen Lebens beschrieben, sondern als Ort, an dem die Jungen im Kontakt mit devianten Mitzöglingen erst recht âverdorbenâ, in einem strengen Anstaltsregime entrechtet und so ihrer Jugend beraubt werden, worauf auch das Zitat im Titel verweist.
Bislang sei â so Martin LĂŒcke in der EinfĂŒhrung â vor allem die Wirkungsgeschichte der ZöglingsaufsĂ€tze Gegenstand geschichtswissenschaftlicher Betrachtungen gewesen. Lampel selbst sei es bei seinen Veröffentlichungen eher âum die möglichst publikumswirksame Aufarbeitung des gesammelten Materialsâ (12f), denn um eine möglichst originalgetreue Wiedergabe der Originaltexte gegangen. Die unklare nachtrĂ€gliche Bearbeitung der AufsĂ€tze durch Lampel habe den Zugang zum eigenen Quellenwert der Texte verstellt. Anliegen der Herausgeber ist es nun, durch die Wiederherstellung ihrer eigenen, ungeglĂ€tteten Sprache und das Aufzeigen der nachtrĂ€glichen Ăberarbeitungsschritte die Jungen als Autobiographen fassbar zu machen (14). Bei der Durchsicht der edierten Texte wird deutlich, dass die Ăberarbeitungen durch Lampel vielfach in einer vorsichtigen Anpassung der Rechtschreibung bestanden, ohne den Sprachduktus der Jugendlichen grundlegend zu verĂ€ndern. FĂŒr die ErschlieĂung der Texte setzen sich Nora Bischoff und Martin LĂŒcke mit quellentypologischen Fragen auseinander und ziehen hierbei die Konzepte des Selbstzeugnisses und des Ego-Dokumentes heran, um daraus abzuleiten, welche quellenkritischen Aspekte bei der Frage nach der AuthentizitĂ€t der Quellen zu berĂŒcksichtigen sind. Hier sei vor allem danach zu fragen, welchen Einfluss die Zugehörigkeit der Jungen aus Struveshof zur sozialen Gruppe der FĂŒrsorgezöglinge hatte, aber auch welcher Schreibkonventionen, welcher Formalisierungen und Stilisierungen sie sich bedienten. DarĂŒber hinaus wird gefragt, inwiefern ĂŒberhaupt durch Ego-Dokumente eine AnnĂ€herung an den Autobiographen selbst möglich ist (20ff). Ein unauflösbares Problem bleibt jedoch die Unklarheit ĂŒber die konkreten UmstĂ€nde der Texterstellung. Das betrifft vor allem den Schreibauftrag Lampels und damit verbunden die Frage, ob die Jungen wussten, dass ihre Texte fĂŒr eine Veröffentlichung mit dem Ziel, die MissstĂ€nde in der FĂŒrsorgeerziehung deutlich zu machen, genutzt werden sollten (45).
Die AufsĂ€tze sind ĂŒber die Geschichte der JugendfĂŒrsorge hinaus vor allem in geschlechtergeschichtlicher Hinsicht von Interesse. Indem die Jugendlichen Texte ĂŒber sich und ihre alltĂ€glichen Erfahrungen verfassten, konstruierten sie ihre biographische IdentitĂ€t, die auch als geschlechtliche IdentitĂ€t gelesen werden kann. Nicht zuletzt floss hier auch ein zeittypisches VerstĂ€ndnis von MĂ€nnlichkeit und Weiblichkeit ein (19). Ein besonderer Mehrwert der AufsĂ€tze liegt darin, dass hier Betroffene der FĂŒrsorgeerziehung in der Weimarer Republik selbst und zwar nicht retrospektiv, sondern erfahrungsnah berichten â ein Umstand mit groĂem Seltenheitswert, was im Ăbrigen auch auf die schriftlichen QuellenĂŒberlieferungen zur FĂŒrsorgeerziehung nach 1945 zutrifft.
Die einleitenden Passagen geben auch fĂŒr einen im kritischen Umgang mit historischen Quellen UngeĂŒbten eine gute methodische EinfĂŒhrung. FĂŒr den nicht mit dem Themenkreis der Entstehung der staatlichen Zwangserziehung im Kaiserreich und ihrer Entwicklung in der Weimarer Republik vertrauten Leser finden sich jedoch nur sehr knapp gehaltene Informationen zu den institutionellen Rahmenbedingungen der FĂŒrsorgeerziehung. Dieser Umstand ĂŒberrascht angesichts der FĂŒlle der zur VerfĂŒgung stehenden Forschungsliteratur zum Thema. Denn nur vor dem Hintergrund des Wissens um die Problematik der FĂŒrsorgeerziehung in der Weimarer Republik lassen sich die EinschĂ€tzungen ĂŒber die PrĂ€gung der Texte durch die normierenden Erfahrungen in der öffentlichen Erziehung, die die Autor/-innen betonen, ĂŒberhaupt vornehmen. Allerdings werden auf der konkreten Anstaltsebene Rahmenbedingungen des Lebens in Struveshof auf der Grundlage weiterfĂŒhrenden Aktenstudiums prĂ€sentiert. Der Band eröffnet zweifellos bemerkenswerte Perspektiven auf die Erfahrungen der von der JugendfĂŒrsorge Betroffenen und erweitert den Quellenfundus zur JugendfĂŒrsorge in der Weimarer Republik um einen wichtigen Bestand.
Matthias Frölich erarbeitete den vorliegenden Quellenband zur Geschichte der Heimerziehung in Westfalen wĂ€hrend seiner Zeit als VolontĂ€r beim Institut fĂŒr westfĂ€lische Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe [4]. Der Band soll einen quellengeleiteten Einstieg in die Thematik im Allgemeinen ermöglichen und darĂŒber hinaus die verschiedenen Ebenen, auf denen der Landschaftsverband fĂŒr die Heimerziehung in Westfalen verantwortlich war, beleuchten (44). So war der Verband ĂŒber das dort angesiedelte Landesjugendamt TrĂ€ger der Ăffentlichen Erziehung, das heiĂt der vormundschaftsgerichtlich angeordneten FĂŒrsorgeerziehung und der Freiwilligen Erziehungshilfe. AuĂerdem fungierte er als TrĂ€ger von vier Erziehungsheimen. Die meisten HeimplĂ€tze stellten aber â wie in anderen BundeslĂ€ndern auch â Heime in konfessioneller TrĂ€gerschaft (17ff). Nach 1961 war der Verband dann auch fĂŒr die institutionelle Beaufsichtigung und Kontrolle aller Heime im Rahmen der Heimaufsicht zustĂ€ndig (6f).
Der Dokumententeil des Bandes bietet eine ĂŒberzeugende Auswahl von Texten zu den Heimen des Landschaftsverbandes und zu den konfessionellen westfĂ€lischen Heimen. Frölich gliedert die ausgewĂ€hlten Dokumente zum einen chronologisch anhand prĂ€gnanter, vor allem auch rechtlicher Entwicklungen der JugendfĂŒrsorge: Die Untergliederung verlĂ€uft von der Nachkriegszeit, ĂŒber erste Modernisierungstendenzen in der Heimerziehung bis zur Durchsetzung der nicht zuletzt durch â68â vorangetriebenen Reformierung auch der westfĂ€lischen Heimerziehung bis zum Anfang der 1980er Jahre. Zum anderen wird ein mehrdimensionaler Zugang zur Entwicklung der westfĂ€lischen Heimerziehung durch eine zusĂ€tzliche thematische Untergliederung ermöglicht: Unter strukturellen und institutionellen Geschichtspunkten der damaligen Heimerziehung finden sich neben einschlĂ€gigen Erlassen des fĂŒr die JugendfĂŒrsorge in Westfalen zustĂ€ndigen Arbeits- und Sozialministeriums auch zahlreiche interne Aktenvermerke und Korrespondenzen des Landesjugendamtes. Unter dem Gliederungspunkt âPĂ€dagogischer und gesellschaftlicher Diskursâ werden vor allem Artikel aus der Fach- und Tagespresse prĂ€sentiert. Dokumente wie etwa Beschwerdebriefe der betroffenen MinderjĂ€hrigen und ihrer Angehörigen sowie Revisionsberichte des Landesjugendamtes werfen Schlaglichter auf den Heimalltag. Um den in den Verwaltungsakten stark marginalisierten Blick der Betroffenen selbst einbeziehen zu können, wurden themenzentrierte Interviews mit ehemaligen Heimkindern gefĂŒhrt. Aber auch ein ehemaliger Erzieher und eine damalige Mitarbeiterin des westfĂ€lischen Landesjugendamtes wurden interviewt. Die daraus entnommenen Teiltranskripte wurden allerdings nicht in den regulĂ€ren Dokumententeil integriert, sondern in einem gesonderten Abschnitt im Anhang zusammengestellt. Das ermöglicht zwar ein schnelles Auffinden der Interviewtexte, gesteht ihnen aber so leider nicht denselben Stellenwert wie den ĂŒbrigen Textquellen zu.
Da der Schwerpunkt des Bandes auf Dokumenten und ErlĂ€uterungen zur Ăffentlichen Erziehung liegt, skizziert Frölich in der Einleitung zunĂ€chst deren rechtliche Grundlagen. Besonders der Ursprung der FĂŒrsorgeerziehung in den âDisziplinierungsmaĂnahmen fĂŒr straffĂ€llig gewordene Jugendlicheâ zur Zeit des Kaiserreichs habe auch nach 1945 âeine schwere Hypothekâ bedeutet, da der FĂŒrsorgeerziehung so âvon Beginn an der Makel des Strafcharaktersâ angehaftet habe (7). Auf der Grundlage der Auswertung von mehr als 1.000 Fallakten aus dem Bereich des Landschaftsverbandes wurde eine ganze Palette von EinweisungsgrĂŒnden der meist aus Arbeiterfamilien der groĂen RuhrgebietsstĂ€dte stammenden MinderjĂ€hrigen in die Ăffentliche Erziehung herausgearbeitet, die unter dem unbestimmten Rechtsbegriff der âVerwahrlosungâ gefasst wurden: Hierzu zĂ€hlten u.a. kriminelle Taten, SchulschwĂ€nzen und Arbeitsverweigerung. Es seien aber auch zahlreiche Opfer körperlicher, auch sexualisierter Gewalt in die Ăffentliche Erziehung eingewiesen worden. Bei Jungen seien von den Jugendbehörden hĂ€ufig Eigentumsdelikte, bei MĂ€dchen im Vergleich deutlich hĂ€ufiger ââgeschlechtliche Ausschweifungenââ unterstellt worden. Eine differenzierte Betreuung dieser Jugendlichen mit ihren verschiedensten Problemlagen habe dann aber in den Heimen oft nicht stattgefunden (8ff).
Entlang der Problemschwerpunkte âArbeitâ, âDisziplinierung und Gewaltâ sowie âsexuelle Gewaltâ skizziert Frölich den Alltag in den westfĂ€lischen Heimen. Der Arbeit von Kindern und Jugendlichen sei vor allem in den 1950er und 1960er Jahren fĂŒr die Selbstversorgung der Heime eine groĂe Bedeutung zugekommen, lange Zeit ohne dass die MinderjĂ€hrigen eine angemessene Entlohnung oder Sozialversicherung erhielten (30ff.). Der Alltag in den Heimen sei vielfach auf Disziplinierung ausgerichtet gewesen und in der erzieherischen Praxis haben Erziehende auch vor der Anwendung von Gewalt gegenĂŒber den MinderjĂ€hrigen nicht zurĂŒckgeschreckt bzw. Gewalt unter den Jugendlichen befördert (35f). Auch in westfĂ€lischen Heimen lassen sich sexuelle Ăbergriffe von Erziehenden auf die ihnen anvertrauten MinderjĂ€hrigen nachweisen. Wo sie bekannt geworden, seien diese auch von den Heimen bzw. den Jugendbehörden zur Anzeige gebracht worden. Die innere Struktur der oft nach auĂen abgeschlossenen Heime habe aber derartige Ăbergriffe begĂŒnstigt (39ff). Diese Befunde zur Heimerziehung in Westfalen reihen sich in ihrem Grundtenor ein in Studien zu anderen bundesdeutschen Regionen und differenzieren sie durch spezifische Befunde fĂŒr Westfalen aus [5].
Unklar bleibt allerdings, was Frölich meint, wenn er in der Zusammenfassung vom âSystem Heimerziehungâ spricht. Zu fragen wĂ€re hier, ob die Menschenrechtsverletzungen, die in der damaligen Heimerziehung geschehen sind, tatsĂ€chlich als âsystematischâ im Sinne von in der Heimerziehung regelmĂ€Ăig produziert, zu bezeichnen sind [6]. Möglicherweise handelte es sich vielmehr um die bitteren Folgen eines Zusammenspiels aus hochgradig problematischen strukturellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Heimerziehung auch noch lange nach 1945 stattfand, dem AnknĂŒpfen an autoritĂ€re Erziehungspraktiken in den Heimen und einem stark defizitorientierten Blick auf Kinder und Jugendliche mit als problematisch angesehenem Verhalten â Faktoren, die Frölich fĂŒr die Heimerziehung in Westfalen zuvor beschreibt.
Dessen ungeachtet erfĂŒllt Frölich seinen Anspruch, eine ââStudienausgabeââ (44) zur Geschichte der Heimerziehung in Westfalen vorgelegt zu haben, in vollem MaĂe. Vor allem durch die Verbindung der Quellentexte mit der vorangestellten, umfangreichen thematischen EinfĂŒhrung, wird ein quellennaher Einstieg in die Thematik ebenso ermöglicht wie eine vertiefende wissenschaftliche Auseinandersetzung.
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart beauftragte die Sozialwissenschaftlerinnen Susanne SchĂ€fer-Walkmann, Constanze Störk-Biber und Hildegard Tries von der Dualen Hochschule Baden-WĂŒrttemberg Stuttgart mit der Aufarbeitung der Heimerziehung der 1950er und 1960er Jahre im Verantwortungsbereich der Diözese. Ziel der daraus hervorgegangenen Publikation ist es, die Lebenswirklichkeit in den katholischen Heimen aus der Sicht von Zeitzeugen darzustellen. Hieraus sollen Erkenntnisse fĂŒr die heutige Heimerziehung abgeleitet werden (15 und 20). [7]
Die Veröffentlichung gliedert sich in sieben Kapitel: Nach einer Darstellung des Arbeitsauftrages, erfolgt eine Rahmung der Heimerziehung der 1950er und 1960er Jahre, indem diese in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang gestellt wird. Im dritten Kapitel stellen die Autorinnen die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte von 19 Heimen in TrĂ€gerschaft der Diözese vor. Kapitel vier und fĂŒnf umfassen die Erinnerungen und EinschĂ€tzungen ehemaliger Heimkinder und Erziehungspersonen an die Heimerziehung der 1950er und 1960er Jahre. Eine Zusammenstellung der Erinnerungen einer Vergleichsgruppe, die die Heimerziehung der 1980er und 1990er Jahre erlebte, findet sich im sechsten Kapitel. Den Abschluss bildet ein Kapitel, das sich mit Fragen des Umgangs mit der Heimerziehung der 1950er und 1960er Jahre in der Diözese befasst.
Die Autorinnen nĂ€hern sich dem Untersuchungsgegenstand ĂŒber drei ZugĂ€nge: Aus soziologischer Perspektive wird auf die Anwendbarkeit des Konzeptes der âtotalen Institutionâ Erving Goffmans fĂŒr die Heimerziehung der 1950er und 1960er Jahre verwiesen. In biographischer Hinsicht wird herausgehoben, dass durch die BerĂŒcksichtigung der Erinnerungen ehemaliger Heimkinder und Erziehender âdichte Beschreibungenâ des Alltags in den Heimen in Anlehnung an Clifford Geertz möglich werden. Durch einen historischen Zugang sollen die âEntstehungsbedingungen der Jugendhilfe zu Anfang des 20. Jahrhundertsâ und die verschiedenen Einweisungsgrundlagen in Heimerziehung nachvollziehbar gemacht werden (21ff). In methodischer Hinsicht werden das Sampling und die Erhebung der Interviews eingehend beschrieben. Die Auswertung der thematisch zusammengestellten Interviewausschnitte erfolgt in Anlehnung an die Forschungslogik der Grounded Theory (24ff).
Die historische Darstellung zu politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, zu Familie und Kindheit, zu Erziehungsvorstellungen und besonders zur staatlichen Ersatzerziehung können vom Leser als gute erste Orientierung genutzt werden. Die Autorinnen selbst beziehen sich in den nachfolgenden Kapiteln aber nur selten auf diese allgemeinen Entwicklungen. Sie stellen heraus, dass die InterviewauszĂŒge âwenig ergĂ€nzender Kommentierung oder weiterfĂŒhrender ErlĂ€uterungâ (279) bedĂŒrfen, da sie fĂŒr sich sprĂ€chen. Eine â gerade auch regionalhistorische â Einordnung hĂ€tte jedoch sicher interessante Perspektiven auf die konkreten Bedingungen in der Diözese eröffnet.
Aus insgesamt 40 Interviews mit ehemaligen Heimkindern und Erziehenden konstruieren die Autorinnen die Lebenswirklichkeit in den Heimen wĂ€hrend der 1950er und 1960er Jahre. Hieraus gehen deutliche strukturelle MissstĂ€nde der damaligen Heimerziehung hervor, die sich u.a. in groĂen Gruppen, desolaten rĂ€umlichen Gegebenheiten und im Mangel an qualifizierten Erziehenden ausdrĂŒckten. DarĂŒber hinaus wird die erlebte Erziehungspraxis geschildert, die nach EinschĂ€tzung der ehemaligen Heimkinder vor allem von persönlicher Entwertung, Lieblosigkeit und WillkĂŒr geprĂ€gt gewesen sei. Das erhebliche MaĂ an geschilderter psychischer, physischer und sexueller Gewalt wird als Alltagserfahrung in den untersuchten Einrichtungen bewertet (154). Im Sample der Erziehenden wurden ĂŒberwiegend Ordensschwestern, aber auch weltliche KrĂ€fte berĂŒcksichtigt, sodass die Bandbreite der beruflichen Qualifikation von pĂ€dagogisch nicht ausgebildetem Personal bis hin zu qualifizierten FachkrĂ€ften deutlich wird. Gerade diese Interviews veranschaulichen vielfach das Dilemma zwischen Pflichtbewusstsein, MitgefĂŒhl und eigener Erschöpfung angesichts der desolaten strukturellen ZustĂ€nde (191ff).
Das Kapitel zur Heimerziehung in den 1980er und 1990er Jahren kann als BrĂŒcke zwischen der problematischen Vergangenheit der 1950er und 1960er Jahre und der Gegenwart verstanden werden. So sollen nicht ausschlieĂlich die MĂ€ngel und das Versagen der Institutionen, sondern auch deren Reformprozess dargestellt werden. Erneut dienen Interviews mit ehemaligen Heimkindern und Erziehungspersonal als Quelle. Die einsetzenden VerĂ€nderungen werden zeitlich mit dem Ausscheiden der Schwestern und der damit verbundenen Einstellung von weltlichem, pĂ€dagogisch und psychologisch ausgebildetem Personal gleichgesetzt (245ff).
Mit den thematischen Zusammenstellungen von Interviewpassagen gelingt es den Autorinnen ein eindrucksvolles und facettenreiches Bild der Lebenswirklichkeit in den Heimen von den 1950ern bis in die 1990er Jahre zu zeichnen. Die Interviews werden hauptsĂ€chlich inhaltlich-thematisch genutzt, ohne die einzelnen biographischen VerlĂ€ufe nachvollziehbar zu machen. Dass Interviews nicht nur auf Erlebnisse in der Vergangenheit, sondern auch auf ihre Verarbeitung im Lebensverlauf bis in die Gegenwart verweisen, wird leider im Buch kaum reflektiert, was aus der Perspektive der rekonstruktiven qualitativen Sozialforschung wĂŒnschenswert gewesen wĂ€re.
Auch wenn die Zeit â so die Autorinnen â die durch die problematischen Erfahrungen in der Heimerziehung verursachten Wunden nicht heilt, bietet das abschlieĂende Kapitel Anregungen fĂŒr einen Umgang mit der Vergangenheit. Es werden Aspekte herausgearbeitet, die auch fĂŒr die heutige Heimerziehung Impulse geben sollen: So fordern die Autorinnen eine Auseinandersetzung mit Stigmatisierungen von Heimkindern sowie mit der Machtposition von Erziehenden. In diesem Zusammenhang messen sie einer tragfĂ€higen pĂ€dagogischen Beziehung groĂe Bedeutung bei (284ff).
Das Buch richtet sich in seiner Gesamtkonzeption vorrangig an Betroffene der Heimerziehung und an ein praxisorientiertes, pĂ€dagogisches Fachpublikum. Insbesondere den in der Kinder- und Jugendhilfe BeschĂ€ftigten bietet das Buch eine gute Möglichkeit, sich mit der Vergangenheit ihres Berufsfeldes auseinanderzusetzen, sich fĂŒr die Erfahrungen der ehemaligen Heimkinder zu sensibilisieren und hieraus Schlussfolgerungen fĂŒr die Gegenwart zu ziehen.
Die Geschichte der stationĂ€ren Kinder- und JugendfĂŒrsorge â das machen die drei besprochenen Publikationen deutlich â war und ist fĂŒr die Betroffenen eine Problemgeschichte. Die Quellenedition âDu Mörder meiner Jugendâ ermöglicht einen Zugang zu authentischen Quellen, die von Jugendlichen in FĂŒrsorgeerziehung der 1920er Jahre verfasst wurden. Die EinfĂŒhrung in die Thematik der FĂŒrsorgeerziehung in der Weimarer Republik ist jedoch sehr knapp gehalten. Im Quellenband zur Heimerziehung in Westfalen nach 1945 ist der thematische Einstieg hingegen ertragreich. WĂ€hrend der Schwerpunkt des Quellenbandes auf gedruckten Quellen liegt, basiert die Publikation âDie Zeit heilt keine Wundenâ zur Heimerziehung der 1950er und 1960er Jahre auf Interviews mit ehemaligen Heimkindern und Erziehenden. Hieraus werden Erkenntnisse fĂŒr die heutige Heimerziehung abgeleitet. Leider fehlt eine Verortung der in den Interviews geschilderten Erlebnisse in die Gesamtbiographie.
[1] Vgl. vor allem Detlev Peukert: Grenzen der Sozialdisziplinierung. Aufstieg und Krise der deutschen JugendfĂŒrsorge 1878 bis 1932. Paderborn: Bund-Verlag 1986; Marcus GrĂ€ser: Der blockierte Wohlfahrtsstaat. Unterschichtenjugend und JugendfĂŒrsorge in der Weimarer Republik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1995; Edward Ross Dickinson: The Politics of German Child Welfare from the Empire to the Federal Republic. Cambridge/Mass.: Harvard University Press 1996; Sabine Blum-Geenen: FĂŒrsorgeerziehung in der Rheinprovinz 1871-1933. Köln: Rheinland-Verlag 1997.
[2] Peter Wensierski: SchlĂ€ge im Namen des Herrn. Die verdrĂ€ngte Geschichte der Heimkinder in der Bundesrepublik. MĂŒnchen: Deutsche Verlags-Anstalt 2006.
[3] Ulrike Meinhof: Bambule. FĂŒrsorge â Sorge fĂŒr wen? Berlin: Verlag Klaus Wagenbach 1971. Das gleichnamige Fernsehspiel wurde ein Jahr zuvor fertiggestellt.
[4] Zum Thema bereits erschienen: Markus Köster: Jugend, Wohlfahrtsstaat und Gesellschaft im Wandel. Westfalen zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik. Paderborn: Ferdinand Schöningh 1999 sowie Markus Köster/Thomas KĂŒster (Hrsg.): Zwischen Disziplinierung und Integration. Das Landesjugendamt als TrĂ€ger öffentlicher Jugendhilfe in Westfalen und Lippe (1924-1999). Paderborn: Ferdinand Schöningh 1999.
[5] Vgl. u.a.: Zum Rheinland Andreas Henkelmann/Uwe Kaminsky/Judith Pierlings/Thomas Swiderek/Sarah Banach (Hrsg.): VerspĂ€tete Modernisierung. Ăffentliche Erziehung im Rheinland â Geschichte der Heimerziehung in Verantwortung des Landesjugendamtes (1945-1972). Essen: Klartext 2011, zu den Einrichtungen der Hannoverschen Landeskirche: Ulrike Winkler/Hans-Walter Schmuhl: Heimwelten. Quellen zur Geschichte der Heimerziehung in Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Werkes der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers e.V. von 1945 bis 1978. Bielefeld: Verlag fĂŒr Regionalgeschichte 2011; bundeslĂ€nderĂŒbergreifend: Bernhard Frings/Uwe Kaminsky: Gehorsam â Ordnung â Religion. Konfessionelle Heimerziehung 1945-1975. MĂŒnster: Aschendorff Verlag 2012, sowie zu Niedersachsen Margret Kraul/Dirk Schumann/Rebecca Eulzer/Anne Kirchberg: Zwischen Verwahrung und Förderung. Heimerziehung in Niedersachsen 1949-1975. Opladen u.a.: Budrich UniPress 2012.
[6] So z.B. Manfred Kappeler: Zwischen den Zeilen gelesen â Kritik des âZwischenberichtsâ des Runden Tisches Heimerziehung, 2010, aus: http://www.gewalt-im-jhh.de/Kappeler_zu_ZB_RTH.pdf, Stand: Mai 2012.
[7] Dazu u.a. Carola Kuhlmann: Erziehungsvorstellungen in der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre. MaĂstĂ€be fĂŒr angemessenes Erziehungsverhalten und fĂŒr Grenzen ausgeĂŒbter Erziehungs- und Anstaltsgewalt. Expertise fĂŒr den Runden Tisch âHeimerziehung in den 50er und 60er Jahren, Bochum, 2010, aus: http://www.rundertisch-heimerziehung.de/documents/RTH_Expertise_
Erziehungsvorstellungen.pdf, [Stand: Juli 2011].
[8] Einen vergleichbaren Ansatz verfolgt auch Carola Kuhlmann: âSo erzieht man keinen Menschen!â. Lebens- und Berufserinnerungen aus der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre. Wiesbaden: VS Verlag fĂŒr Sozialwissenschaften 2008.
