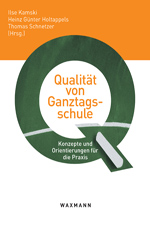 Durch die Darstellung erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse sowie mithilfe wegweisender BeitrĂ€ge zur Praxisumsetzung beabsichtigen die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes der QualitĂ€tsdebatte um die Ganztagsschule eine orientierende und anregende Grundlage zu geben. GemÀà dem Anliegen besteht der Sammelband aus den drei Teilen schultheoretischer Rahmen, praxisorientierte Bearbeitung von Schwerpunktthemen und schlieĂlich Zukunftsperspektiven.
Durch die Darstellung erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse sowie mithilfe wegweisender BeitrĂ€ge zur Praxisumsetzung beabsichtigen die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes der QualitĂ€tsdebatte um die Ganztagsschule eine orientierende und anregende Grundlage zu geben. GemÀà dem Anliegen besteht der Sammelband aus den drei Teilen schultheoretischer Rahmen, praxisorientierte Bearbeitung von Schwerpunktthemen und schlieĂlich Zukunftsperspektiven.
Im ersten Teil fĂŒhrt Heinz GĂŒnter Holtappels systemisch-normative sowie empirisch-konzeptionelle Annahmen und Erkenntnisse zur Ganztagsschule zu einem QualitĂ€tsmodell zusammen. Im Zuge dessen integriert er gewinnbringend Annahmen des Angebots-Nutzungs-Modells sowie EinflĂŒsse von SchulentwicklungsbemĂŒhungen in das herkömmliche CIPO-Modell zur SchulqualitĂ€t, das sich aus dem Zusammenspiel der Dimensionen und Merkmale der Input-, Prozess- und OutputqualitĂ€t unter BerĂŒcksichtigung des sozialen Kontextes erschlieĂt, und verweist dabei sowohl auf die KomplexitĂ€t schulischer WirkungszusammenhĂ€nge als auch auf die damit vorhandene Schwierigkeit, Effekte einzelner Faktoren empirisch zu bestimmen. Seine Darstellungen von speziellen QualitĂ€tsdimensionen und Merkmalen sowie einiger teilweise bestĂ€tigter ZusammenhĂ€nge bieten somit nicht nur Anhaltspunkte fĂŒr einzelschulische Entwicklungsprozesse, sondern befördern darĂŒber hinaus eine Systematik von ForschungsbemĂŒhungen.
Witlof VollstĂ€dt fokussiert in seinem Beitrag die Kompetenzorientierung in modernen Bildungssettings. Sofern Schul- und UnterrichtsqualitĂ€t ĂŒber den Weg der Kompetenzorientierung und mit Blick auf den âschulischen Outputâ verbessert werden sollen, sei ein differenziertes VerstĂ€ndnis darĂŒber notwendig, welche Konsequenzen mit einer solchen Orientierung verbunden sind. Die anschlieĂenden Konkretisierungen und Beschreibungen zentraler Konzepte sind trotz ihrer dichten und fĂŒr Laien teilweise nur mit Vorkenntnissen nachvollziehbaren Ableitungen durchaus schlĂŒssig und weisen schlussendlich einen Bezug zur Ganztagsschule aus.
Simone Menke stellt in ihrem Aufsatz die Ergebnisse eines inhaltsanalytischen, internetbasierten Vergleichs lĂ€nderspezifischer QualitĂ€tsoffensiven zur Ganztagsschule dar. Sie kommt zu dem nicht ĂŒberraschenden Befund, dass diese sehr unterschiedlich gestaltet sind. HintergrĂŒnde, Ursachen und Konsequenzen der Kriterienkataloge werden von der Autorin allerdings höchstens randstĂ€ndig berĂŒcksichtigt.
Heinz GĂŒnter Holtappels, Ilse Kamski und Thomas Schnetzer schlieĂen den ersten Teil mit der Beschreibung des QualitĂ€tsrahmens fĂŒr Ganztagsschulen des Dortmunder Instituts fĂŒr Schulentwicklung. Mit der systematischen und umfangreichen Beschreibung von QualitĂ€tsbereichen, -merkmalen, -kriterien und -indikatoren der System-, Prozess- und Outputdimension sollen den Lesern aus der Schulpraxis und Forschung nicht nur Orientierungshilfen und Anregungen fĂŒr die Entwicklung und Gestaltung einer Ganztagsschule, sondern auch MaĂstĂ€be an die Hand gegeben werden, die im Rahmen evaluativer Verfahren dienlich sind.
Zu Beginn des zweiten Teils stellt Katrin Höhmann ihre Auffassung vor, dass eine verĂ€nderte Unterrichts- und Lernkultur unter den Gegebenheiten einer Ganztagsschule besser zu etablieren sei. Sie beschreibt die Notwendigkeit, Faktoren, wie etwa das BildungsverstĂ€ndis einer Schule, die Organisationsform oder auch Kooperationsmöglichkeiten, und deren wechselseitige AbhĂ€ngigkeit zielorientiert in den Blick zu nehmen. Besonderes Augenmerk legt sie auf den Umgang mit der Zeit, dem Raum, den Bildungsinhalten, der Gruppenbildung und der Personalfrage. Die realen Möglichkeiten der einzelnen Schule erschlieĂen sich dann vor dem Hintergrund der administrativen Ebene, der Ebene der schulinternen Verbindlichkeiten und der individuellen Nutzung.
Ausgehend vom zeitlichen Plus von Ganztagsschulen definiert Thomas Schnetzer relevante Begrifflichkeiten zur Zeitstrukturierung und beschreibt Gestaltungs- und Rhythmisierungsmöglichkeiten. Gleichwohl wird selbst der an schulischer QualitÀt interessierte und vorgebildete Leser der ZwangslÀufigkeit und Richtung der angerissenen ZusammenhÀnge nicht ohne weiteres folgen können.
Mithilfe der Darstellung von ganztagsschultypischen Kooperationsformen und -partnern gelingt Ilse Kamski im anschlieĂenden Beitrag eine adĂ€quate und umfassende Betrachtung einer vielfĂ€ltigen inner- und auĂerschulischen Kooperationspraxis. Auch die SchĂŒler- und Elternpartizipation werden berechtigterweise mit angefĂŒhrt. Vor dem Hintergrund ganztagsschulischer Ziele plĂ€diert sie fĂŒr eine konzeptionelle Vor- und Zusammenarbeit aller an Schule beteiligten Gruppen und Einzelpersonen und liefert zugleich Anregungen zur Gestaltung von Kooperationen in Ganztagsschulen.
Stefan Appel fokussiert in seinem Beitrag ausgehend von altersbezogenen Lebens- und LernbedĂŒrfnissen der SchĂŒler die Notwendigkeit, adĂ€quate ganztagsschulspezifische RĂ€ume und eine entsprechende Ausstattung bereitzuhalten. Er kritisiert die unzureichende BerĂŒcksichtigung dieses Aspekts innerhalb bildungspolitischer Richtlinien und setzt dieser einen Ăberblick sowie Mindestvoraussetzungen grundlegender RĂ€umlichkeiten an Ganztagsschulen entgegen. Die grundsĂ€tzlich plausibel erscheinende Herangehensweise lĂ€sst dennoch die dargestellten hohen Anforderungen vor dem Hintergrund konkreter schulischer Bedingungen realitĂ€tsfern und somit unerreichbar erscheinen.
Wolfram Rollett und Katja Tillmann prĂ€sentieren Ergebnisse zum Personaleinsatz der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG). FĂŒr den qualitativen Ausbau sei es unabdingbar, sich nicht nur materielle, rĂ€umliche und finanzielle Ressourcen kritisch vor Augen zu fĂŒhren, sondern einen Blick auf das heterogene Personal, deren Qualifikationen, BeschĂ€ftigungssituationen, Einsatzbereiche, EinschĂ€tzungen und Sicht auf die Kooperation untereinander zu werfen. Anhand der zusammengestellten Befunde kommen die Autoren zu dem Schluss, dass es fĂŒr eine QualitĂ€tssteigerung notwendig sei, LehrkrĂ€fte stĂ€rker als bisher in die Ganztagsgestaltung einzubinden, auf weiteres pĂ€dagogisches Personal mit sehr geringem BeschĂ€ftigungsumfang eher zu verzichten und auf eine pĂ€dagogische Qualifikation Wert zu legen.
Lernprozesse zum Thema Partizipation machen im VerstĂ€ndnis Franz Bettmers das Zusammenspiel von drei Erfahrungsdimensionen notwendig: auf einer pĂ€dagogischen Dimension geht es um Kompetenzentwicklung, auf einer politischen Dimension um reale Einflussnahme sowie auf einer Dimension des Engagements um die konkrete (Mit-) Gestaltung der eigenen Umwelt. Viele (ganztags-) schulische Projekte, wie etwa Mitbestimmungsgremien, stoĂen jedoch aufgrund rechtlicher Vorgaben an Grenzen, so dass vielerorts eine Diskrepanz zwischen normativen AnsprĂŒchen und Möglichkeiten der partizipativen Einflussnahme wahrzunehmen ist. Bettmer plĂ€diert dafĂŒr, eine Ausweitung der Eltern- und SchĂŒlerpartizipation als langwierigen und âoffenen Prozessâ (151) zu begreifen, der in einer gemeinsamen und transparenten Gestaltung zu Inhalten und Formen der Zusammenarbeit fĂŒhrt. Seine kritische Sicht ist in der Lage, weiterfĂŒhrende Diskussionen anzuregen.
Ernst Rösner eröffnet den dritten Teil des Sammelbandes mit der ausfĂŒhrlichen Beschreibung des demografischen Wandels und seiner Bedeutung fĂŒr Schule allgemein und die Ganztagsschule im Speziellen. Sinkende Geburtenzahlen, das Schulwahlverhalten der Eltern, Wanderungseffekte und bildungspolitische Entscheidungen könnten sich in sehr unterschiedlicher Weise auf die AttraktivitĂ€t und die RaumkapazitĂ€ten einzelner Schularten auswirken. ErnĂŒchternd kommt Rösner zu der Auffassung, dass zukĂŒnftig der Ganztagsschule nicht zwangslĂ€ufig und keinesfalls flĂ€chendeckend gröĂere Chancen eingerĂ€umt werden können, obwohl von einer Zunahme an rĂ€umlichen Ressourcen â zumindest theoretisch â auszugehen ist.
Anja Durdel leitet in ihrem Aufsatz schlĂŒssig die Notwendigkeit spezieller UnterstĂŒtzungsangebote fĂŒr Schulen in Reformprozessen her. Im Anschluss daran referiert sie die Arbeitsweise und die Erfolge des Begleitprogramms fĂŒr Ganztagsschulen âIdeen fĂŒr mehr! GanztĂ€gig lernenâ.
Nils Kleemann plĂ€diert in seinem Aufsatz ĂŒberzeugend fĂŒr neue flexible Arbeitszeitregelungen und angepasste schulische Bedingungen (z.B. RĂ€umlichkeiten), die es dem Lehrer ermöglichen, den komplexen Anforderungen der Ganztagsschule gerecht zu werden. Seine Kritik richtet sich in konstruktiver Weise auf die systemischen Rahmenbedingungen (Standards der Schulverwaltung / Schulaufsicht) welche die ReformbemĂŒhungen der Schulen ausbremsen. Unter den aktuellen Gegebenheiten verwundere es nicht, wenn die Ganztagsschule mit ihren Implikationen vielerorts zur âBetreuungseinrichtungâ (176) verkomme.
Im letzten Beitrag des Sammelbandes kommen die Herausgeber selbst noch einmal zu Wort und widmen sich explizit einem Ausblick zur Schulentwicklung in Ganztagsschulen. Zusammenfassend werden Ergebnisse der Ganztagsschulforschung, die auf fördernde und hemmende Faktoren verweisen, dargestellt. QualitĂ€t bedarf dabei vor allem einer zeitintensiven konzeptionellen, engagierten Zusammenarbeit aller Beteiligten, einer konsequenten Verfolgung gesetzter Ziele und ein Angehen von Schulentwicklung mithilfe von QualitĂ€tssicherungsmaĂnahmen sowie externen UnterstĂŒtzungssystemen. ZukĂŒnftige UnterstĂŒtzungsbedarfe, die diese zentralen EinflussgröĂen aufgreifen und zu verbessern helfen, werden am Ende abgeleitet.
Insgesamt verweist der Sammelband auf wichtige QualitĂ€tsaspekte der Ganztagsschulentwicklung und gibt in zahlreichen BeitrĂ€gen Anregungen zu zentralen StellgröĂen in Schulentwicklungsprozessen. Dort, wo Anregungen und AnsprĂŒche an die QualitĂ€t von Ganztagsangeboten formuliert werden, fehlt jedoch der bildungsföderale Bezug. Allerdings muss bezweifelt werden, ob dieser ĂŒberhaupt im Rahmen einer solchen Publikation leistbar gewesen wĂ€re. Vor dem Hintergrund regionaler Rahmenbedingen werden viele der formulierten generellen AnsprĂŒche fĂŒr den jeweiligen Praktiker angemessen erscheinen. Hingegen sind auch zu Recht MaĂstĂ€be und Orientierungspunkte gesetzt, deren Erreichbarkeit umfangreiche, ambitionierte, zeitintensive und individuelle Entwicklungswege der Schulen voraussetzen. Die sehr unterschiedlich ausgerichteten BeitrĂ€ge werden nicht immer alle sich mit Ganztagsschule beschĂ€ftigenden Akteure in gleicher Weise ansprechen. Dem Leser wird dadurch eine hohe Syntheseleistung abverlangt, die ein zusammenfassender abschlieĂender Beitrag erleichtert hĂ€tte.
