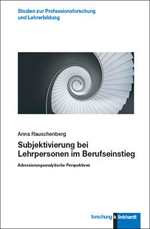 Die Frage nach dem Werden professioneller LehrerInnen beschäftigt das Feld der Schulforschung aus unterschiedlichen Perspektiven. Anna Rauschenberg ordnet sich mit dem Blick auf berufseinsteigende Lehrpersonen dem Gebiet der berufsbiografischen Professionsforschung zu (10) und legt mit ihrer subjektivierungstheoretischen Studie einen wissenschaftstheoretischen Beitrag zu diesem Feld vor. Anhand der adressierungsanalytischen Rekonstruktion von Sequenzen zweier Interviews, die im Rahmen eines von Uwe Herricks und Manuela Keller-Schneider geleiteten Forschungsprojektes zur Kompetenzentwicklung und Beanspruchung von Lehrpersonen im Berufseinstieg (KomBest-Studie) erstellt wurden, beforscht sie das Feld der Berufseinstiegsforschung selbst. Den Fokus legt die Autorin somit nicht auf die erzählte berufliche Praxis der Befragten, sondern auf die soziale Praxis des Interviews beziehungsweise die wissenschaftliche Forschung zum Berufseinstieg selbst. Sie interessiert sich dafür, wie im Rahmen wissenschaftlicher Praxis das Subjekt „Lehrperson im Berufseinstieg“ hervorgebracht und konstituiert wird und welche Irritationen das für die Berufseinstiegsforschung als auch die qualitative Interviewforschung mit sich bringt.
Die Frage nach dem Werden professioneller LehrerInnen beschäftigt das Feld der Schulforschung aus unterschiedlichen Perspektiven. Anna Rauschenberg ordnet sich mit dem Blick auf berufseinsteigende Lehrpersonen dem Gebiet der berufsbiografischen Professionsforschung zu (10) und legt mit ihrer subjektivierungstheoretischen Studie einen wissenschaftstheoretischen Beitrag zu diesem Feld vor. Anhand der adressierungsanalytischen Rekonstruktion von Sequenzen zweier Interviews, die im Rahmen eines von Uwe Herricks und Manuela Keller-Schneider geleiteten Forschungsprojektes zur Kompetenzentwicklung und Beanspruchung von Lehrpersonen im Berufseinstieg (KomBest-Studie) erstellt wurden, beforscht sie das Feld der Berufseinstiegsforschung selbst. Den Fokus legt die Autorin somit nicht auf die erzählte berufliche Praxis der Befragten, sondern auf die soziale Praxis des Interviews beziehungsweise die wissenschaftliche Forschung zum Berufseinstieg selbst. Sie interessiert sich dafür, wie im Rahmen wissenschaftlicher Praxis das Subjekt „Lehrperson im Berufseinstieg“ hervorgebracht und konstituiert wird und welche Irritationen das für die Berufseinstiegsforschung als auch die qualitative Interviewforschung mit sich bringt.
Einleitend fĂĽhrt die Autorin dafĂĽr in die zentralen Themenbereiche der Studie ein und verortet die Untersuchung im Feld der Professionsforschung. Zudem wird die Forschungsarbeit in den zuvor genannten ĂĽbergeordneten Forschungszusammenhang eingefĂĽgt (KomBest-Studie).
Entlang bisweilen sehr verdichteter Ausführungen stellt das zweite Kapitel die subjekttheoretischen Grundannahmen der Arbeit heraus. In diesem Zusammenhang beschreibt Rauschenberg die historische Entwicklung gegenwärtiger Subjektauffassungen und geht auf die Positionen beziehungsweise Subjektbegriffe der ReferenzautorInnen (Louis Althusser, Michel Foucault und Judith Butler) ein. Überdies weist die Autorin auf die Herausforderung erziehungswissenschaftlicher Erforschung von Subjektivierung hin: Sich dem Dilemma anzunehmen, dass Subjekt zum Forschungsobjekt zu machen und damit selbst immer wieder zu produzieren, was untersucht werden soll.
Anschließend daran schärft Anna Rauschenberg ihr Erkenntnisinteresse. Hierfür stellt sie zentrale Studien vor, welche die Schnittstelle zwischen Professions- und LehrerInnenforschung bedienen und die sie entlang vergleichbarer Aspekte bespricht. Gleichzeitig macht sie anhand der Studien unterschiedliche Varianten der Herangehensweise an die Erforschung von Subjektivierung deutlich und diskutiert diese.
Im vierten Kapitel werden die diskursiven Ordnungsbildungen des Forschungsfeldes dekonstruiert. Hier treibt Rauschenberg die Frage um, „in welcher Weise die Genese des konkreten Subjekts „Lehrperson im Berufseinstieg“ in Fragen der LehrerInnenbildung und Professionsforschung diskursiv verstrickt ist“ (62).
Das Forschungsdesign der Studie entfaltet sich in den nachfolgenden drei Kapiteln. Im Besonderen eruiert die Autorin, wie sich Subjektivierungsprozesse in Interviews vollziehen und stellt methodologische Ăśberlegungen zur adressierungsanalytischen Auswertung dieses Datenmaterials an. AnschlieĂźend stellt sie die rahmende Studie KomBest vor und legt sowohl methodische Aspekte wie die Auswahl des empirischen Materials als auch das Vorgehen der Auswertung dar.
In zwei Fallstudien (Kapitel 8 und 9) rekonstruiert Rauschenberg die soziale Herstellungspraxis von Interviewgesprächen. Hierfür fokussiert sie sowohl die Einstiegs- und Abschlusssequenzen als auch die Antworten auf den Erzählimpuls, um offenzulegen, wie im Adressierungs- und Re-Adressierungsgeschehen ein Subjekt „Lehrperson im Berufseinstieg“ situativ verfertigt wird.
Das Fazit verhandelt abschlieĂźend den methodologischen Wert der Studie und stellt die Ergebnisse in Zusammenhang mit der KomBest Studie sowie dem Feld der Professionsforschung. Neben der Hervorhebung der bedeutungsgenerierenden Kraft des Interviews geht sie dabei durchaus kritisch sowohl auf die theoretisch-konzeptionelle Verortung als auch die Forschungspraxis der Adressierungsanalyse ein.
Insgesamt zeichnet sich die aus einer Dissertationsschrift hervorgegangene Veröffentlichung durch eine komprimierte und strukturierte Darstellung aus, die einen guten Überblick über das Forschungsfeld gibt und zu intensiveren Blicken einlädt. Im Zuge einer aktuell steigenden Zahl an Forschungsarbeiten mit subjektivierungstheoretischer und adressierungsanalytischer Ausrichtung präsentiert und diskutiert Rauschenberg eine „neue Anwendungsweise der Adressierungsanalyse“ (114) – und das nicht nur im Hinblick auf das Interviewformat, sondern auch für die Verbindung von Adressierungsanalyse und einer „diskursanalytisch inspirierte[n, AB] Untersuchung des Forschungsfelds“ (184) sowie dem Versuch, eine Adressierungsanalyse als Wissenschaftsforschung zu betreiben. Der Blick auf die Verbindungslinien von Forschungsdiskurs und Forschungspraxis und die Frage nach der Verwobenheit von erziehungswissenschaftlicher Forschung mit ihrem Gegenstand zeichnen die Arbeit aus. Auch wenn die methodenkritischen Thesen bezüglich der Adressierungsanalyse an einigen Stellen diffus bleiben, können sie in der Mehrheit als Anregung zu weiterführenden methodologischen Fragen gelesen werden. Darüber hinaus sensibilisiert die Ergebnisdiskussion für die Bedeutung der Relationierung fallspezifisch rekonstruierter (Re-)Adressierungsmuster und habitueller Orientierungen.
