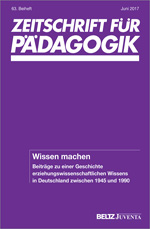 Viele BeitrĂ€ge zum Diskurs erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Wissens weisen normative ZĂŒge auf: Mit der Unterscheidung zwischen wissenschaftlich erzeugtem Wissen und praxisbezogenem Professionswissen oder der Abgrenzung des Wissensbegriffs zu Konstrukten wie Meinungen, Einstellungen oder Ăberzeugungen, wird nicht selten ein Begriff des Wissens vorausgesetzt, anstatt diesen zum Gegenstand der Analyse zu machen. Vor dem Hintergrund eines wachsenden politischen und ökonomischen Interesses an (Steuerungs-)Wissen ĂŒber effiziente Lernstrategien, an der Verbesserung schulischer Leistungen oder Verringerung sozialer Ungleichheit durch Bildung, ist in der Erziehungswissenschaft eine Diskussion ĂŒber die Wissensproduktion wieder virulent geworden. Diese Entwicklung wirft Fragen nach der Formierung, Reformierung und Legitimation erziehungswissenschaftlichen Wissens auf und fĂŒhrt zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit fĂŒr wissensgeschichtliche Analysen: Wer sind die Akteure der Wissensproduktion? Welches Wissen produzieren sie, und welche Rolle spielen dabei soziale, politische und ökonomische VerĂ€nderungen?
Viele BeitrĂ€ge zum Diskurs erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Wissens weisen normative ZĂŒge auf: Mit der Unterscheidung zwischen wissenschaftlich erzeugtem Wissen und praxisbezogenem Professionswissen oder der Abgrenzung des Wissensbegriffs zu Konstrukten wie Meinungen, Einstellungen oder Ăberzeugungen, wird nicht selten ein Begriff des Wissens vorausgesetzt, anstatt diesen zum Gegenstand der Analyse zu machen. Vor dem Hintergrund eines wachsenden politischen und ökonomischen Interesses an (Steuerungs-)Wissen ĂŒber effiziente Lernstrategien, an der Verbesserung schulischer Leistungen oder Verringerung sozialer Ungleichheit durch Bildung, ist in der Erziehungswissenschaft eine Diskussion ĂŒber die Wissensproduktion wieder virulent geworden. Diese Entwicklung wirft Fragen nach der Formierung, Reformierung und Legitimation erziehungswissenschaftlichen Wissens auf und fĂŒhrt zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit fĂŒr wissensgeschichtliche Analysen: Wer sind die Akteure der Wissensproduktion? Welches Wissen produzieren sie, und welche Rolle spielen dabei soziale, politische und ökonomische VerĂ€nderungen?
Mit solchen Fragen befassen sich die BeitrĂ€ge im 63. Beiheft der âZeitschrift fĂŒr PĂ€dagogikâ. Sie widmen sich der Auseinandersetzung mit dem Wissensbegriff in der Erziehungswissenschaft und lenken âden Blick auf einen Ansatz [...], der sich programmatisch mit der historiographischen Rekonstruktion und Analyse der jeweiligen historischen Struktur, Herstellung und Geltung von Wissen [âŠ] befasstâ (7f.). Die BeitrĂ€ge haben aus wissensgeschichtlicher Perspektive die deutsche Bildungspolitik und Erziehungswissenschaft zwischen 1945 und 1990 zum Gegenstand. Ihre Autor_innen beabsichtigen, soziale, politische und ökonomische Bedingungen der Entstehung und Etablierung wissenschaftlichen Wissens sowie den âTransfer und [die] Transformation von Wissen zwischen Akteuren, Organisationen und gesellschaftliche[n] Handlungsfeldernâ (10) zu rekonstruieren.
Julia Kurig und Britta Behm fragen im ersten Teil des Bandes nach zeitlichen KontinuitĂ€ten (erziehungs-)wissenschaftlichen Wissens. Kurig rekonstruiert âsymbolische Praktikenâ (16) geisteswissenschaftlicher PĂ€dagogik. Deren bildungstheoretisches Angebot âAbendlĂ€ndische Bildungâ ist eine Kampfansage gegen die Technokratisierung des Lebens nach 1945 und hat sowohl disziplinĂ€re als auch schulpolitische und schulpraktische Diskurse in der Nachkriegszeit beeinflusst. Wie sich parallel dazu die empirisch-experimentelle Disziplinausrichtung der PĂ€dagogik etablierte, ist Behms Forschungsgegenstand. Sie untersucht die Formierung der Bildungsforschung in Westdeutschland. Deren AnfĂ€nge gehen nicht auf die GrĂŒndung des Instituts fĂŒr Bildungsforschung (IfB) der Max-Planck-Gesellschaft im Jahr 1963 zurĂŒck, wie frĂŒhere Untersuchungen nahelegen, sondern die Wurzeln der empirischen Bildungsforschung liegen, so Behms zentrale These, in der 1946 beginnenden Planungsphase der âHochschule fĂŒr Internationale PĂ€dagogische Forschungâ (HIPF). Im Fokus ihrer Analyse der GrĂŒndungsunterlagen des IfB und der HIPF stehen Akteure und ihre Handlungsstrategien, Modi der Forschungsorganisation, die diskursive Praxis der Wissenschaftsmodellierung und eine Historiographie der Wissensmuster. Beide Institutionen entwickeln ein WissenschaftsverstĂ€ndnis, dem zufolge Erziehungswissenschaft zur Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme beitragen soll. Ihre theoretischen und methodischen AnsĂ€tze lassen eine PrĂ€ferenz fĂŒr empirische Forschung erkennen und auch bei den politischen UnterstĂŒtzer_innen und Wissenschafter_innen gibt es groĂe Ăberschneidungen zwischen dem IfB und dem HIPF.
Im zweiten Abschnitt âWissen und Beratungâ untersuchen Edith Glaser und Norbert Grube die Einflussnahme politikberatender Gremien und Organisationen auf das erziehungswissenschaftliche Wissensfeld. Glaser erforscht die Arbeiten des âDeutschen Ausschusses fĂŒr das Erziehungs- und Bildungswesenâ, der als erstes Bildungsberatungsgremium der jungen Bundesrepublik mit einem Vorschlag zur Neustrukturierung des Schulwesens beauftragt wurde und dessen Gutachten und Empfehlungen 1970 die Grundlage fĂŒr die Verabschiedung des Strukturplans des Bildungswesens bildeten. Unter Verwendung der Begriffe Denkstil und Denkkollektiv von Ludwik Fleck analysiert Glaser die Zirkulation des Wissens und die ReprĂ€sentation dieses Bildungsberatungsgremiums nach auĂen. Grube fragt in seinem Beitrag nach der Bedeutung des âInstituts fĂŒr Demoskopie Allensbachâ fĂŒr die Konturierung des westdeutschen bildungspolitischen Wissensfeldes zwischen den 1950er und 1980er Jahren. Seine Analyse erziehungswissenschaftlicher Wissensproduktion und -zirkulation lĂ€sst sich an der Schnittstelle von Gesellschaft, Wissenschaft und Politik verorten. Dabei werden konfligierende (politische) Interessen im Denkkollektiv deutlich, aber die Frage bleibt offen, wie die Emergenz von miteinander in Konflikt stehenden Verarbeitungen des Wahrgenommenen innerhalb eines Denkkollektivs erklĂ€rbar ist und warum ein bestimmtes Wissen seinen Geltungsanspruch gegenĂŒber konkurrierenden Wissensformen durchsetzt.
Wie sich ein Wissensfeld im Spannungsfeld internationaler Debatten konstituiert, zeigen Eckhardt Fuchs und Kathrin Henne im Abschnitt âWissen und Steuerungâ am Beispiel der deutschen Schulbuchrevision, die als zentraler Bestandteil der Bildungssemantik internationaler VerstĂ€ndigung angesehen wurde. Entlang des Konzepts des âpolicy borrowingâ identifizieren sie ein âweitverzweigtes, mehrdimensionales Netzwerk, das faktisch die âTransferkanĂ€leâ jenseits geographischer Grenzen bildeteâ (119) und dessen nationale Beteiligung ‒ neben dem internationalen Akteur UNESCO und der britischen Besatzungsmacht ‒ vor allem mit dem Namen Georg Eckert, dem Leiter des Schulbuchinstituts in Braunschweig, verbunden wird. Rita Nikolais und Kerstin Rothes Thema sind schulpolitische Entscheidungen in den Jahren 1947, 1951 und 1991. In ihrer inhaltsanalytischen Bearbeitung von Plenarprotokollen der Berliner Stadtverordnetenversammlung und des Berliner Abgeordnetenhauses untersuchen die Autorinnen die den Argumentationen zugrundeliegenden normativen Ziel- und Wertehaltungen der Akteure sowie die Bedeutung erziehungswissenschaftlichen Wissens fĂŒr politische Entscheidungen. Sandra Wenk analysiert jenes Wissen, das politische Aushandlungsprozesse und Praktiken der nordrhein-westfĂ€lischen Landschulreform der 1960er Jahre bestimmte. Sie operiert mit einem âoffenenâ Wissensbegriff, der ĂŒber wissenschaftlich erzeugtes Wissen und Expert_innenwissen hinausgeht, und stellt die Etablierung eines Reformmodells dar, das sich wesentlich an den Ăberzeugungen der Eltern und der lokalen Bevölkerung orientierte.
Sabine Reh eröffnet den letzten Abschnitt â(Erziehungswissenschaftliches) Wissen und Praxisâ mit einem Beitrag ĂŒber eine besondere Form der erziehungswissenschaftlichen Tatsachenforschung. Zwischen den 1950er und spĂ€ten 1970er Jahren beschĂ€ftigte die âHochschule fĂŒr Internationale PĂ€dagogische Forschungâ (HIPF) vom Schuldienst abgeordnete oder beurlaubte Lehrpersonen als wissenschaftliche Mitarbeiter_innen. Praktische Problemlagen, die sie im Unterricht oder in Diskussionen auf Fachtagungen identifiziert hatten, waren der Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen von Kleingruppen im Schul- und Unterrichtsalltag. Reh zeigt auf, wie damit eine pragmatische Form der Bildungsforschung erziehungswissenschaftliches Wissen erzeugte, das sich in der Produktion gegenĂŒber heute aktueller empirischer Bildungsforschung durch einen praxisnahen Forschungszugang und den Einsatz eines breiten Spektrums sozialwissenschaftlicher Methoden auszeichnete. Monika Mattes fragt in ihrem Beitrag nach der diskursiven Vorgeschichte der Annahme, dass Wohlbefinden schulischen Leistungserfolg vorhersage. Ihre These ist, dass sich ab den 1970er Jahren eine Rhetorik im kulturellen Leitbild des Schulwesens ausbreitete, die dem subjektiven Befinden der SchĂŒler_innen und Lehrpersonen einen höheren Stellenwert zuschreibt. Ausgehend von der Gesamtschuldebatte rekonstruiert sie die Zirkulation der WissensbestĂ€nde in den Feldern Ăffentlichkeit, (empirische) Forschung und Schulpraxis und zeigt, dass Wohlbefinden in den Diskursen kein trennscharfes Konzept war, sondern sich als Konglomerat aus Werten und Emotionen darstellt, das âden Ăbergang zum âtherapeutischen Zeitalterâ markierteâ (202). SchlieĂlich untersucht Heinz-Elmar Tenorth die Wissensproduktion der wissenschaftlichen PĂ€dagogik in der DDR. In seinen Analysen werden âdie Vernetzung von Wissenschaft und Politik, die eigene Praxis der Wissenschaften und auch der Umgang der Wissenschaften mit den Erwartungen und PrĂ€missen ihrer Umwelt zentralâ (213). Tenorths systematische Analyse interner Logiken der Erziehungsforschung und externer Logiken der â politischen â Umwelt zeigt, dass die theoretische und methodische Entwicklung der PĂ€dagogik in WidersprĂŒche mit den kommunistischen Vorhaben der politischen FĂŒhrung gerĂ€t. Aber selbst dann, wenn die Erziehungsforschung der Ideologie des Systems folgt, gibt sie ihre eigene Forschungslogik auch gegen den Einspruch der Politik nicht auf.
Mit den im 63. Beiheft der âZeitschrift fĂŒr PĂ€dagogikâ publizierten BeitrĂ€gen findet eine folgenreiche Verschiebung in der Analyse von bildungspolitischem und erziehungswissenschaftlichem Wissen statt. WĂ€hrend Oelkers und Tenorth zu Beginn der 1990er Jahre im 27. Beiheft der âZeitschrift fĂŒr PĂ€dagogikâ unter dem Titel âPĂ€dagogisches Wissenâ die Funktionen, Strukturen und Charakteristika der unterschiedlichen Erscheinungsformen von Wissen beschrieben und Möglichkeiten der Verbesserung von pĂ€dagogischem Wissen aufgezeigt haben, geht es nun um die historische Analyse der Wissensproduktion. Protokollen und Materialien ĂŒber die Arbeit in politischen und pĂ€dagogischen AusschĂŒssen und Institutionen wird so eine gröĂere Bedeutung eingerĂ€umt. Eine solche Sichtweise hat drei Konsequenzen: Erstens lassen sich neue Akteure erziehungswissenschaftlicher Wissensproduktion identifizieren, wie etwa bei Reh beurlaubte Lehrer_innen, die durch ihre Sonderstellung als wissenschaftliche Mitarbeiter_innen neue Wissensformen hervorbringen, oder, so bei Glaser oder Grube, Institutionen, die als wissenschaftliche Akteure jenseits der UniversitĂ€ten zur Etablierung neuer Typen von Wissen beitragen. Das fĂŒhrt, zweitens, dazu, dass externalistische und internalistische Momente der Wissensproduktion, wie beispielsweise Tenorths Beitrag zeigt, aufeinander bezogen werden. Drittens kann nicht von einem bestehenden Begriff des erziehungswissenschaftlichen Wissens ausgegangen werden, sondern die Rekonstruktion des Wissensbegriffs ist ein zentraler Bestandteil der Analyse von Wissensproduktionen. Die im Beiheft enthaltenen Arbeiten machen deutlich, wie die Perspektive der Wissensgeschichte in der erziehungswissenschaftlichen Disziplin dazu beitragen kann, unterschiedliche wissenserzeugende Akteure, widerstreitende und parallele Entwicklungen sowie BrĂŒche und Kontingenzen in der Wissensproduktion sichtbar zu machen. Gleichzeitig eröffnet ein wissensgeschichtlicher Zugang die Thematisierung der Funktion und LegitimitĂ€t unterschiedlicher Wissensformen.
