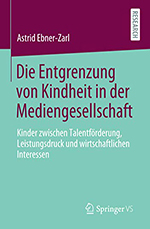 Astrid Ebner-Zarl hat sich im Rahmen ihrer Dissertation einer Mammut-Aufgabe gestellt. Auf 725 Seiten befasst sie sich mit der These von einer entgrenzten Kindheit. Hierzu greift sie zum einen auf interdisziplinĂ€re AnsĂ€tze der Kindheits- und Jugendforschung zurĂŒck. Zum anderen stellt sie Ergebnisse einer eigenen Medienanalyse vor. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Frage, welche Bilder von Kindheit in Medienangeboten fĂŒr Kinder transportiert werden, inwieweit sich geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen lassen und inwieweit sich das Konzept der Entgrenzung zur Beschreibung von Gegenwartskindheit eignet. Hierzu rollt sie im zweiten Kapitel den Forschungsstand umfassend aus und nimmt das Konzept der Entgrenzung aus soziologischer und psychologischer Perspektive in den Blick, was sie zu dem Schluss kommen lĂ€sst, dass der Begriff der Entgrenzung zwar hĂ€ufig verwendet werde, jedoch empirisch nicht unterfĂŒttert sei (50f.).
Astrid Ebner-Zarl hat sich im Rahmen ihrer Dissertation einer Mammut-Aufgabe gestellt. Auf 725 Seiten befasst sie sich mit der These von einer entgrenzten Kindheit. Hierzu greift sie zum einen auf interdisziplinĂ€re AnsĂ€tze der Kindheits- und Jugendforschung zurĂŒck. Zum anderen stellt sie Ergebnisse einer eigenen Medienanalyse vor. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Frage, welche Bilder von Kindheit in Medienangeboten fĂŒr Kinder transportiert werden, inwieweit sich geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen lassen und inwieweit sich das Konzept der Entgrenzung zur Beschreibung von Gegenwartskindheit eignet. Hierzu rollt sie im zweiten Kapitel den Forschungsstand umfassend aus und nimmt das Konzept der Entgrenzung aus soziologischer und psychologischer Perspektive in den Blick, was sie zu dem Schluss kommen lĂ€sst, dass der Begriff der Entgrenzung zwar hĂ€ufig verwendet werde, jedoch empirisch nicht unterfĂŒttert sei (50f.).
Angesichts dieses Desiderats greift Astrid Ebner-Zarl auf das Konzept der âdifferenziellen Zeitgenossenschaftâ von Heinz Hengst [1, 2] zurĂŒck, mit dem der Fokus auf die Ăhnlichkeiten und Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen gelegt wird und nicht auf den Vergleich von Kindern unterschiedlicher Generationen. Ihre AusfĂŒhrungen mĂŒnden schlieĂlich in der âDifferenzierung zwischen Kindheit und Kindsein, das Denken im Plural (Kindheiten, verschiedene Formen des Kindseins, Entgrenzungen, Begrenzungen), aber auch die Offenheit, (sic!) ĂŒber den Entgrenzungsbegriff und ĂŒber Kindheit hinaus, (sic!) differenzielle Zeitgenoss*innenschaft in den Blick zu nehmen bzw. die enge Verwobenheit von Kindheit/Kindsein mit der allgemeinen Verfasstheit der Gesellschaft zu bedenken.â (150).
Letztere nimmt sie im dritten Kapitel anhand von vier Dimensionen in den Blick, die auch fĂŒr ihre Medienanalyse zentrale Leitplanken bilden: Mediatisierung, Sexualisierung, Kommerzialisierung sowie Leistungs- und Talentförderung und daraus resultierender Druck. In differenzierter Weise stellt sie den Forschungsstand zu diesen vier Themenfeldern dar und reflektiert diesen auf das Konzept der Entgrenzung, wobei sie zu der EinschĂ€tzung gelangt, dass aus soziologischer Perspektive ein Konzept der Entgrenzung nur rudimentĂ€r möglich sei (358).
FĂŒr die Analyse der ausgewĂ€hlten Sendungen ergibt sich, dass Astrid Ebner-Zarl die dort reprĂ€sentierten Bilder von Kindheit oder Kindsein nicht fĂŒr sich interpretiert, sondern die Kinder als Darstellende im Vergleich zu den erwachsenen Moderator*innen und Juror*innen betrachtet. Zur Beantwortung der oben genannten Forschungsfragen wĂ€hlt sie Casting Shows als Analysegegenstand, konkret die Beispiele âKiddy Contestâ und âThe Voice Kidsâ. Bei der Sendung âKiddy Contestâ handelt es sich um eine österreichische Musik-Casting Show mit 25-jĂ€hriger Tradition, in der Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren gegeneinander antreten. âThe Voice Kidsâ ist ein Ă€hnliches Sendungsformat, das seit 2014 in Deutschland ausgestrahlt wird. Drei Folgen des âKiddy Contestsâ (2015, 2016, 2017) sowie eine Staffel von âThe Voice Kidsâ (2017) wurden eingehender analysiert. Die leitfadengestĂŒtzte Inhaltsanalyse orientierte sich zum einen an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring [3] und Schreier [4] und zum anderen an dem medienanalytischen Vorgehen von Paus-Haase [5], Bause [6] sowie Mikos [7]. Die von der Autorin adaptierte Vorgehensweise, die auf verschiedenen Formen des Codierens basieren (z. B. deskribierendes, notierendes, transkribierendes, kontextualisierendes sowie konkludierendes Codieren) wird ausfĂŒhrlich dargelegt und unterstreicht die KomplexitĂ€t der Analyse. Astrid Ebner-Zarl nimmt alle Bestandteile der Sendungen in den Blick, einschlieĂlich der dargebotenen und zum Teil abgewandelten Songs. Die AusfĂŒhrungen zur (langwierigen) Entwicklung des Instruments, die auch schlieĂlich zu der Entscheidung gefĂŒhrt haben, das Material manuell und nicht softwaregestĂŒtzt zu codieren, mögen fĂŒr einige Leser*innen mitunter sehr viel Raum einnehmen; fĂŒr diejenigen, die sich mit Ă€hnlichen praktischen Fragen qualitativer Inhaltsanalyse befassen, können diese â auch mit Blick auf die Reflektion des Vorgehens in Kapitel 6 â durchaus hilfreich sein und einige Umwege ersparen.
In Kapitel fĂŒnf werden auf 254 Seiten die Ergebnisse der Medienanalyse vorgestellt und auf die obengenannten vier zentralen Dimensionen reflektiert. Der Autorin zufolge spiegeln sich die Dimensionen Kommerzialisierung und FrĂŒhförderung/Leistungsorientierung in beiden Sendungen am stĂ€rksten wider. Mediatisierung zeigt sich am deutlichsten an der direkten und indirekten Einbindung von Social Media (z. B. Einbindung von Social Media Stars in die Show, eigenen begleitenden Social-Media-KanĂ€len etc.). Formen der Sexualisierung finden sich indes vergleichsweise wenig und eher in Bezug auf MĂ€dchen.
Insgesamt â so schlussfolgert die Autorin in Kapitel sieben â lassen sich in den analysierten Sendungen Konstruktionen verschiedenster Kindheitsbilder identifizieren, z. B. der/die kompetente Selbstvermarkter*in, der/die Konsument*in, der/die professionelle SĂ€nger*in bzw. der potenzielle Star, das erfahrene oder das sorgsam gestylte Kind (698). Gleichzeitig weisen diese Bilder vom Kind bzw. Kindsein viele Ăberschneidungen mit den Bildern von Erwachsenen auf (z.B. ĂŒber Liedauswahl, Styling, professionelle Selbstdarstellung etc.). Auch im Hinblick auf die untersuchten Genderunterschiede stellt die Autorin eine âKoexistenz aus Ăhnlichkeiten und Unterschieden zwischen den Geschlechtergruppen, aber auch aus Ăberwindung und Reproduktion von Geschlechterstereotypenâ (706) fest. Die Antwort auf die Frage, inwieweit sich das Konzept der Entgrenzung zur Beschreibung von Gegenwartskindheit eignet, mutet etwas ausweichend an, wenn die Autorin auf das Konzept der differenziellen Zeitgenoss*innenschaft verweist und als Antwort die Hypothese postuliert, dass beide Konzepte ineinandergreifen wĂŒrden: âZeitgenossInnenschaft ist zunĂ€chst die gemeinsame Grundlage, in die alle Gesellschaftsmitglieder zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Gesellschaft eingebettet sind. ZeitgenossInnenschaft bringt per se mit sich, dass in vielen Hinsichten keine Grenzen zwischen Kindern und Erwachsenen existieren, zumindest keine Grenzen grundlegender Natur. Aus dieser ZeitgenossInnenschaft kann sich in manchen Hinsichten auch spezifische Entgrenzung von Kindheit ergeben, z. B. im Zeitvergleich [âŠ] oder im entwicklungspsychologischen Sinne [âŠ].â (712). Damit ist jedoch nicht das von der Autorin selbst identifizierte Problem gelöst, dass Grenzen bekannt sein mĂŒssen, um Entgrenzungen erfassen zu können. Auch zeigt sich die Autorin gegenĂŒber den Möglichkeiten einer systematischen Analyse des VerhĂ€ltnisses zwischen Zeitgenoss*innenschaft und Entgrenzung angesichts fehlender Kontextinformationen und Befunde eher skeptisch. Stattdessen verweist sie auf mögliche Anschlussforschungen in Form von kulturellen Vergleichen und Rezeptionsstudien (722). Den Abschluss der Arbeit bilden Empfehlungen fĂŒr die Ăberarbeitung der beiden untersuchten Sendungsformate, wobei die Autorin grundsĂ€tzlich in Frage stellt, inwieweit es medial ausgetragene Talentwettbewerbe fĂŒr Kinder ĂŒberhaupt braucht (723).
Mit ihrer Arbeit hat Astrid Ebner-Zarl eine (ge-)wichtige Grundlage geschaffen, die all jenen ans Herz zu legen ist, die sich mit der Frage befassen, wie Kinder und Jugendliche in mediatisierten Lebenswelten aufwachsen und was Kindheit bzw. Kindsein heute bedeutet. Auch denjenigen, die sich mit der qualitativen Analyse audiovisueller Medieninhalte beschÀftigen, finden in dem Band hilfreiche methodische Anregungen und Reflektionen. Insofern lohnt es sich in mehrfacher Hinsicht, einen Blick in dieses umfassende Werk zu werfen und sich mit den theoretischen und methodischen Herausforderungen und Grenzen gegenwÀrtiger Kindheits- und Medienforschung auseinanderzusetzen.
[1] Hengst, H. (2005). Kindheitsforschung, sozialer Wandel, Zeitgenossenschaft. In H. Hengst & H. Zeiher (Hrsg.), Kindheit soziologisch (S. 245-265). Wiesbaden: VS Verlag fĂŒr Sozialwissenschaften.
[2] Hengst, H. (2013). Kindheit im 21. Jahrhundert: Differenzielle Zeitgenossenschaft. Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
[3] Mayring, P. (2008). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 10. Aufl., Weinheim/Basel: Beltz
[4] Schreier, M. (2014). Varianten qualitativer Inhaltsanalyse: Ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten. Forum: Qualitative Sozialforschung/Social Research, 15(1), 1-27.
[5] Paus-Haase, I. (1992). Neue Helden fĂŒr die Kleinen. Das (un)heimliche Kinderprogramm des Fernsehens. MĂŒnster/Hamburg: LIT Verlag, IâVII.
[6] Bause, U., Rullmann, A. & Welke, O. (1992). Von MĂ€rchen und anderen Geschichten. Zur theoretischen Basis und Methode der Analyse. In I. Paus-Haase (Hrsg.), Neue Helden fĂŒr die Kleinen. Das (un)heimliche Kinderprogramm des Fernsehens (S. 57-94). MĂŒnster/Hamburg: LIT Verlag.
[7] Mikos, L. (2008). Film- und Fernsehanalyse. 2. Aufl., Konstanz: UVK.
