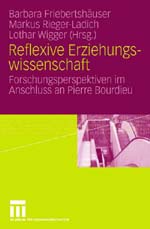 In auĂerordentlicher Breite versammelt der Band unter dem Titel âReflexive Erziehungswissenschaftâ Perspektiven, die sich im Anschluss an Pierre Bourdieu fĂŒr erziehungswissenschaftliches Denken ergeben. Dabei setzen sich die HerausgeberInnen dezidiert vom gleichnamigen Programm Lenzens ab, um die âLeerstelleâ (11) eines noch zu realisierenden Projekts âreflexiver Erziehungswissenschaftâ in eigener Weise zu fĂŒllen (vgl. 9). WĂ€hrend Lenzen ReflexivitĂ€t eher auf die GegenstĂ€nde erziehungswissenschaftlichen Denkens beziehe, verpflichten sich die Autoren und Autorinnen einem Modus von Wissenschaft, der in Anschluss an Bourdieu âTheorie, Empirie und Praxis in ganz spezifischer Weise in den Blick nimmtâ (14). Im Rahmen einer so verstandenen ReflexivitĂ€t seien soziale Herkunft, Position im Feld sowie Position im sozialen Raum als je spezifische Bedingungen wissenschaftlicher Praxis zu untersuchen. Bourdieu selbst verstehe ein solches Sich-Verhalten zur eigenen wissenschaftlichen Praxis jedoch nicht als letztgĂŒltige Selbstobjektivierung, vielmehr sei ihm die Standortlosigkeit eines solchen Unternehmens bewusst (13). Nicht zuletzt jedoch versprechen sich die Autoren und Autorinnen von einer so verstandenen ReflexivitĂ€t Immunisierungsgewinne gegenĂŒber Instrumentalisierungen ökonomischer und politischer Natur (vgl.11f.).
In auĂerordentlicher Breite versammelt der Band unter dem Titel âReflexive Erziehungswissenschaftâ Perspektiven, die sich im Anschluss an Pierre Bourdieu fĂŒr erziehungswissenschaftliches Denken ergeben. Dabei setzen sich die HerausgeberInnen dezidiert vom gleichnamigen Programm Lenzens ab, um die âLeerstelleâ (11) eines noch zu realisierenden Projekts âreflexiver Erziehungswissenschaftâ in eigener Weise zu fĂŒllen (vgl. 9). WĂ€hrend Lenzen ReflexivitĂ€t eher auf die GegenstĂ€nde erziehungswissenschaftlichen Denkens beziehe, verpflichten sich die Autoren und Autorinnen einem Modus von Wissenschaft, der in Anschluss an Bourdieu âTheorie, Empirie und Praxis in ganz spezifischer Weise in den Blick nimmtâ (14). Im Rahmen einer so verstandenen ReflexivitĂ€t seien soziale Herkunft, Position im Feld sowie Position im sozialen Raum als je spezifische Bedingungen wissenschaftlicher Praxis zu untersuchen. Bourdieu selbst verstehe ein solches Sich-Verhalten zur eigenen wissenschaftlichen Praxis jedoch nicht als letztgĂŒltige Selbstobjektivierung, vielmehr sei ihm die Standortlosigkeit eines solchen Unternehmens bewusst (13). Nicht zuletzt jedoch versprechen sich die Autoren und Autorinnen von einer so verstandenen ReflexivitĂ€t Immunisierungsgewinne gegenĂŒber Instrumentalisierungen ökonomischer und politischer Natur (vgl.11f.).
Der Band gliedert sich in vier Teile, die sich erstens theoretischen Verortungen sowie der Rezeption Bourdieus widmen, zweitens vom Habitus-Konzept ausgehende Ăberlegungen versammeln, drittens âfeldtheoretische Perspektivenâ (6) einfangen sowie schlieĂlich bildungssoziologische Arbeiten einbeziehen.
Im ersten Teil zeichnet Liebau nicht allein (auch seine eigenen) Rezeptionslinien nach, sondern zeigt auch die Provokationen bourdieuscher Perspektiven fĂŒr pĂ€dagogisches Denken auf. Diese bestĂŒnden vor allem in der Suspendierung bestimmter fĂŒr pĂ€dagogische Perspektiven konstitutiver Momente: âDie Illusion der freien pĂ€dagogischen Vernunft, die Illusion der geistigen Bildung, die Illusion der IdentitĂ€t, die Illusion der Chancengleichheit, die Illusion der pĂ€dagogischen Autonomie, die Illusion der AufklĂ€rung â Bourdieu mutet PĂ€dagogen ziemlich viel zuâ (55). Dass es sich dennoch lohne, auch aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive mit Bourdieu zu denken, sieht Liebau vor allem in der Reflexion auf die eigene Vermitteltheit gegeben, durch die Freiheitsgrade gewonnen werden könnten (vgl. 56). Es stellt sich allerdings die Frage, worin die ReibungsflĂ€chen zwischen pĂ€dagogischen und kultursoziologischen Perspektiven genau bestehen, um auf dieser Basis die Grenzen gegenwĂ€rtigen erziehungswissenschaftlichen Arbeitens und deren mögliche Verschiebung herauszuarbeiten.
Die AufsĂ€tze des zweiten Teils beziehen sich vorrangig auf Bourdieus Habitus-Konzept. Es werden Untersuchungen vorgestellt, die das Konzept zum einen umsetzen bzw. anwenden (Brake/BĂŒchner, Michel/Wittpoth) und die es zum anderen einer systematischen Analyse zufĂŒhren (Wigger, Alkemeyer, Brumlik). WĂ€hrend die Ăberlegungen zum Zusammenhang von Habitus und Bildung(sstrategien) erwartbare Ergebnisse hervorbringen, erweisen sich jene BezĂŒge, die sich den Schwierigkeiten in Bourdieus Arbeiten widmen, als anregend und innovativ. So interessieren an der Studie von Michel und Wittpoth, die dem Prozessieren des Habitusâ an Hand von Bildbetrachtungen auf die Spur kommen wollen, weniger die erwartbaren Unterschiede von Betrachtungsweisen entsprechend der sozialen Herkunft der Akteure. Spannend sind vielmehr die methodologischen Probleme, die sich aus der Anlage der Untersuchung ergeben, nĂ€mlich etwas nicht sprachlich Verfasstes wie den Habitus erheben zu wollen (83ff.). Ăhnliches lĂ€sst sich auch fĂŒr den Beitrag Alkemeyers sagen, dessen Ăberlegungen zur körperlichen Dimension von Bildung an Hand ethnographischer Analysen unmittelbar ĂŒberzeugen (vgl. 128ff.). Alkemeyer selbst ist dabei einer der wenigen Autoren des Bandes, der die eigenen Analysen nochmals reflexiv wendet und so auf eine NĂ€he neoliberaler und pĂ€dagogischer Perspektiven, etwa in der FunktionalitĂ€t eines flexiblen, selbstregierten und autonomen Akteurs, aufmerksam macht (vgl.137). ReflexivitĂ€t im Sinne Bourdieus hĂ€tte sich darĂŒber hinaus auf den Schreibenden als Akteur in einem Feld sowie das Schreiben als Praxis in seiner sozialen Situiertheit und Bedingtheit beziehen können â ein Aspekt, den man im Sinne der oben genannten ReflexivitĂ€t hĂ€tte erwarten können.
Im dritten Teil sind unter der Perspektive der Feldtheorie BeitrĂ€ge versammelt, die dem Anspruch eines reflexiven Umgangs mit Bourdieus Begriffen gerecht werden (Rieger-Ladich, Forneck/Wrana, Neumann/Honig). Der bisher eher verhalten rezipierte Feldbegriff zeigt seine Fruchtbarkeit in diesen Analysen. Rieger-Ladich nutzt das Angebot der bourdieuschen Heuristik als âReflexionsangebotâ (159) zur Analyse des erziehungswissenschaftlichen Feldes, das als Kampf um Positionen und Deutungshoheiten erscheint (vgl. 173). Leider entfaltet Rieger-Ladich an dieser Stelle nicht mehr als ein Programm, dem die eigentlichen feldtheoretischen Analysen folgen mĂŒssten. Denkbar wĂ€re darĂŒber hinaus, die Bedingungen des eigenen Sprechens mit dem begrifflichem Instrumentarium Bourdieus zu analysieren bzw. die FĂ€rbung, die Bourdieus Termini in ihrer erziehungswissenschaftlichen Verwendung erhalten, zu untersuchen, wie dies Wigger in seinem Vergleich von Habitus- und Bildungsbegriff leistet (vgl. 101ff.).
Die im vierten und letzten Teil versammelten bildungssoziologischen Perspektiven schlieĂlich fĂŒhren Ergebnisse aus Studien an, die sich explizit dem zentralen bourdieuschen Topos des sozialstrukturell bedingten Bildungserfolgs widmen. Interessant erscheint hierbei vor allem Bremers Arbeit, die implizit den emphatischen Bildungsbegriff Humboldts einer zweckfreien Auseinandersetzung mit der Welt auf dessen spezifische HabitusabhĂ€ngigkeit und daraus folgend auf seine distinktive Funktion der Legitimation bestimmter Bildungspraktiken hin befragt (291f.). So erscheint jenes selbstorganisierte Lernen als milieubedingter Umgang mit Wissen und birgt dementsprechendes Reibungspotenzial zwischen Lernarrangements des Bildungssystems und den dort agierenden Akteuren (294ff.). Inwieweit durch die hierbei vorgenommene VerknĂŒpfung milieu- und habitustheoretischer ZugĂ€nge bestimmte UnschĂ€rfen in Kauf genommen werden (wie etwa die Differenz von Bildung und Lernen, die im empirischen Teil schnell ĂŒbergangen wird), wĂ€re genauer zu befragen als dies vorliegend unternommen worden ist. An dieser Stelle schlieĂt sich das Problem der stets etwas hilflos anmutenden Forderungen an die PĂ€dagogik bzw. Bildungspolitik an: Die nicht nur an dieser Stelle geĂ€uĂerten normativen Leerformeln wĂ€ren mit Bourdieu gerade hinsichtlich ihrer Adressierung wie Wirksamkeit zu befragen, da der eigene Standort der Beobachtung und Kritik selbst in die Prozesse gesellschaftlicher Reproduktion verflochten bleibt.
Insgesamt kann man feststellen, dass der Band in Darstellung und Breite möglicher AnschlĂŒsse an Bourdieu im Rahmen erziehungswissenschaftlichen Denkens die Lesererwartungen erfĂŒllt. Der Anspruch, der sich dem Programm einer âreflexiven Erziehungswissenschaftâ verpflichtet, wird dagegen nur vereinzelt eingelöst. Ăberzeugend sind so vor allem jene AufsĂ€tze, die den Band als Forum fĂŒr Reflexionen jenseits der ErgebnisprĂ€sentation eigener Studien nutzen, wie dies z.B. Neumanns/Honigs Ăberlegungen zur Herstellung von âguter Praxisâ durch die Akteure selbst darstellen. Kaum Ăberraschungen bieten jene Arbeiten, die Bourdieu wiederholen, anwenden bzw. von Bourdieu aus eigene Gebiete sichten (SchlĂŒter/Faulstich-Wieland, Brake/BĂŒchner, Lange-Vester, Baumgart, FriebertshĂ€user, Schultheis). Innovativ sind dagegen jene AufsĂ€tze, die Bourdieus Theoriearbeit als aus konkreten empirischen Fragen entstandene Heuristiken verstehen und so SpannungsverhĂ€ltnisse offen halten (Rieger-Ladich, Wigger, Forneck/Wrana, Neumann/Honig, Alkemeyer). Ausgehend von diesen BeitrĂ€gen bleibt zu hoffen, dass die Rezeption Bourdieus in der Erziehungswissenschaft eine Fortsetzung findet, welche die AnschlussfĂ€higkeit seines Arbeitens, vor allem aber auch die Reflexionsgrenzen und Perspektivenverschiebungen einer erziehungswissenschaftlichen Rezeption verdeutlicht.
SchlieĂlich wĂ€re dem Band ein sondierender Beitrag ĂŒber die Differenzen und InkompatibilitĂ€ten Bourdieuscher und pĂ€dagogischer Perspektiven zu wĂŒnschen gewesen. Fragen, die sich im Anschluss an die spezifischen epistemologischen und methodologischen Annahmen Bourdieus ergeben, werden nur selten gestreift: Was bedeutet tatsĂ€chlich ein Denken jenseits der Dichotomie von Subjektivismus und Objektivismus? Wie verhĂ€lt sich die Ăberwindung eines Körper-Geist-Dualismus zum pĂ€dagogischen Denken von Bildungsprozessen, die Welt- und SelbstverhĂ€ltnisse thematisieren? Wie lĂ€sst sich Bildung im Anschluss an Bourdieu denken, wenn dessen Konzept sozialer Akteure bzw. âagentsâ ein immer schon vorhandenes VerstrickungsverhĂ€ltnis von Selbst und Welt annimmt? Wo und wie wĂ€ren pĂ€dagogische Interventionen und BildungsbemĂŒhungen zu legitimieren? So werden die angefĂŒhrten Merkmale einer âreflexiven Erziehungswissenschaftâ, die sich ĂŒber die Standortgebundenheit des Aussagenden, des Ausgesagten und deren Feldgebundenheit zu vergewissern habe, in den BeitrĂ€gen eher selten ausgefĂŒhrt. Die eigenen Praktiken jedoch als Formen symbolischer Gewalt zu verstehen und mit befremdenden Blick zu beobachten â wie dies Rieger-Ladich vorschlĂ€gt â wĂ€re tatsĂ€chlich ein Gewinn aus der Konfrontation erziehungswissenschaftlichen Denkens mit Bourdieu. UnabhĂ€ngig von einer Etikettierung als âreflexiver Erziehungswissenschaftâ wĂ€re dem Fach jene ReflexivitĂ€t zu wĂŒnschen, die auch im Angebot bourdieuschen Denkens besteht â nĂ€mlich Befragungen der eigenen Voraussetzungen sowie Situiertheit der eigenen Praktiken systematisch zu verankern.
