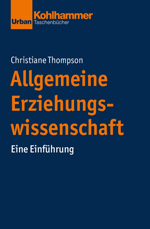 Christiane Thompson liegt mit ihrem EinfĂŒhrungsband, sofern man fachlich einschlĂ€gig aufgestellte Verlagsprospekte der letzten Jahre konsultiert, durchaus im Trend. Allgemein-erziehungswissenschaftliche EinfĂŒhrungsliteratur scheint â dem jahrzehntelangen buchstĂ€blichen Graubereich der Skripten- und Handapparatekultur vollends entwachsen â zu einer vom Verlagswesen erstaunlich intensiv lancierten Textgattung geworden zu sein, die angesichts der Vielzahl an Neuerscheinungen und teilweise beeindruckenden Auflagenzahlen mittlerweile wohl auch als taugliches Asset innerhalb akademischer Publikationsbilanzierungserfordernisse zu figurieren vermag. Wo jeweils freilich aus systematischer Perspektive z.B. die Grenze zwischen disziplinĂ€r-sachlogischer Notwendigkeit, persönlichem Profilierungs- oder pragmatischem Verwertungsdruck mehr oder weniger privatistisch gelagerter LektĂŒreprĂ€ferenzen von AutorInnen verlĂ€uft, bleibt im Einzelfall nicht nur den LeserInnen zur ErwĂ€gung aufgegeben, sondern könnte in Anbetracht der Orientierungsfunktion von fachlichen EinfĂŒhrungswerken durchaus zum Thema disziplinpolitischer SelbstverstĂ€ndigungen auch abseits wechselhafter kerncurricularer Konjunkturlagen werden: Wie und als was und auf Grundlage welcher begrifflich-kategorialer, ideengeschichtlicher oder methodologisch justierter Kriterien wird der Gegenstandsbereich Allgemeiner Erziehungswissenschaft (AEW) tradiert und heute vorgestellt?
Christiane Thompson liegt mit ihrem EinfĂŒhrungsband, sofern man fachlich einschlĂ€gig aufgestellte Verlagsprospekte der letzten Jahre konsultiert, durchaus im Trend. Allgemein-erziehungswissenschaftliche EinfĂŒhrungsliteratur scheint â dem jahrzehntelangen buchstĂ€blichen Graubereich der Skripten- und Handapparatekultur vollends entwachsen â zu einer vom Verlagswesen erstaunlich intensiv lancierten Textgattung geworden zu sein, die angesichts der Vielzahl an Neuerscheinungen und teilweise beeindruckenden Auflagenzahlen mittlerweile wohl auch als taugliches Asset innerhalb akademischer Publikationsbilanzierungserfordernisse zu figurieren vermag. Wo jeweils freilich aus systematischer Perspektive z.B. die Grenze zwischen disziplinĂ€r-sachlogischer Notwendigkeit, persönlichem Profilierungs- oder pragmatischem Verwertungsdruck mehr oder weniger privatistisch gelagerter LektĂŒreprĂ€ferenzen von AutorInnen verlĂ€uft, bleibt im Einzelfall nicht nur den LeserInnen zur ErwĂ€gung aufgegeben, sondern könnte in Anbetracht der Orientierungsfunktion von fachlichen EinfĂŒhrungswerken durchaus zum Thema disziplinpolitischer SelbstverstĂ€ndigungen auch abseits wechselhafter kerncurricularer Konjunkturlagen werden: Wie und als was und auf Grundlage welcher begrifflich-kategorialer, ideengeschichtlicher oder methodologisch justierter Kriterien wird der Gegenstandsbereich Allgemeiner Erziehungswissenschaft (AEW) tradiert und heute vorgestellt?
Christiane Thompsons EinfĂŒhrung als eben ein (weiterer) Antwortversuch auf diese Fragen fĂ€llt nun im Umfang kompakt, im Differenzierungsgrad vielschichtig und hinsichtlich der ZugĂ€nglichkeit fĂŒr interessierte LeserInnen gleichwohl bedachtsam ausgewĂ€hlt wie im Durchgang erfrischend leichtgĂ€ngig aus. Aus der Perspektive einer zielgruppenspezifischen Lesart (d.h. fĂŒr StudieneinsteigerInnen bzw. -interessierte) lassen sich die 11 Kapitel des Bandes grob in drei Abschnitte gliedern: âAspekte wissenschaftlicher Grundlegungâ (15) charakterisieren die ersten 3 Kapitel des Bandes, bevor â geradezu als modus operandi par excellence der erziehungswissenschaftlichen EinfĂŒhrungsliteratur â ausgewĂ€hlte einheimische bzw. mit dauerhaftem Aufenthaltstitel ausgestattete Begriffe (hier: Erziehung, Bildung, Lernen, Kompetenz und Sozialisation, Kap. 4-8) vorgestellt und diskutiert werden. Der dritte Abschnitt schlieĂlich gibt entlang der Diskussion aktueller âerziehungswissenschaftlicher Problemfigurenâ (16) wie Wirksamkeit (Kap. 9), Ungleichheit, Differenz und AlteritĂ€t (Kap. 10) sowie trans- und posthumanistischer Perspektiven (Kap. 11) Einblicke in gegenwĂ€rtige Herausforderungen und Arbeitsfelder allgemein-erziehungswissenschaftlicher Forschung.
Bereits im ersten Abschnitt von Thompsons Buch â die Kapitel 1-3 verhandeln zunĂ€chst wissenschaftshistorische und -theoretische Grundlagen des abendlĂ€ndischen WissenschaftsverstĂ€ndnisses (18-34), bevor der Fokus auf die Umstrittenheit einer disziplinĂ€r bestimmten Erziehungswissenschaft gerichtet (35-55) und schlieĂlich das Spezifikum wissenschaftlichen Arbeitens (56-70) in den Blick genommen wird â fĂ€llt auf, dass das die AusfĂŒhrungen des Bandes strukturierende Merkmal nicht in der Darlegung einer â oftmals in EinfĂŒhrungswerken suggerierten â ideengeschichtlich-enzyklopĂ€dischen KontinuitĂ€t von Grundlegungsfiguren und VerweisungszusammenhĂ€ngen ĂŒber die Epochen hinweg kulminiert. Im Unterschied dazu werden paradigmatische EinsĂ€tze im Denken ausgewĂ€hlt und in ihrer ZĂ€surhaftigkeit und BrĂŒchigkeit auch deutlich herausgestellt, was es erlaubt â so Thompson in gedanklicher NĂ€he zu einem Vorschlag Jörg Ruhloffs, dem der vorliegende Band gewidmet ist â den Gegenstandsbereich der Erziehungswissenschaft gleichsam als âepistemologisches Korrelat eines unaufgeklĂ€rten Problemkomplexesâ (Ruhloff 2006: 37) [1] zu prĂ€sentieren: Die fachlich tradierten GegenstĂ€nde sind, so Thompson, demnach im Wege der Thematisierung und Konfrontation von ââProblemâ, âProblemstellungâ oder âHerausforderungââ (14) zu erschlieĂen, um so jeweils âan den erreichten Wissensstand anknĂŒpfenâ (Ruhloff 2006: 42) zu können, âohne sich darum in Traditionen verfangen zu mĂŒssen.â (ebd.)
Mit kurzen RĂŒckblicken auf Platons Differenzierung von doxa und episteme (18f.), auf die AnfĂ€nge neuzeitlicher Wissenschaft mit Descartesâ Meditationen und Galileis Experimenten (20-23), sowie schlieĂlich auf Kants Vernunftkritik ruft die Autorin so mit einem keineswegs als antisystematisch fehlzudeutetenden Mut zur LĂŒcke Kronzeugen oder Wegmarken fĂŒr die Herausbildung eines spezifisch wissenschaftlichen Modus der WelterschlieĂung auf, dessen Theoretisierung, Institutionalisierung und schlieĂlich auch Historisierung im Zuge des 19. und 20. Jahrhunderts anhand der Debatten und Protagonisten im Einzugsbereich des Wiener Kreises (25-30) und der Arbeiten Flecks, Kuhns und Bourdieus (30-34) schlieĂlich an ein VerstĂ€ndnis von Wissenschaft als einer auch gesellschaftlich bedingten und somit irreduzibel kritikablen Praxis heranfĂŒhrt. Aspekte der disziplinĂ€ren IdentitĂ€t und der institutionellen Ausdifferenzierung der (eben vergleichsweise sehr jungen) Erziehungswissenschaft erlĂ€utert Thompson dann ausfĂŒhrlicher anhand der Auswirkungen des sozialwissenschaftlichen Positivismusstreits (Popper, Adorno) der 1960er Jahre, an dessen AuslĂ€ufern wiederum sich die wohl wirkmĂ€chtigste architektonische Binnendifferenzierung herauskristallisiert, nĂ€mlich jene zwischen geisteswissenschaftlicher PĂ€dagogik (Flitner), empirischer Erziehungswissenschaft (Brezinka) und kritischer Erziehungswissenschaft (Mollenhauer) (42-50). Eine glĂ€ttende oder Hauptströmungen und Rezeptionsachsen harmonisierende Lesart wird hier bei Thompson ebenso wenig begĂŒnstigt, wie auch dem anderenorts zuweilen zu beobachtenden Drang standgehalten wird, Strömungen oder Konjunkturen im Sinne eines quasi-naturalisierten Fortschrittsgeschehens von Denkungsarten nahezulegen. Im Gegensatz dazu bleibe angesichts der abschlieĂenden Problematisierung von Paradigmen als Ordnungsinstanzen disziplinĂ€rer Entwicklung und IdentitĂ€t (52f.) âder Widerstreit leitend. Nach dem Gesagten kann das Ziel ohnehin nicht in einer Auflösung und Vereinheitlichung der Erziehungswissenschaft liegen. (âŠ) Der Fortgang der Wissenschaft beruht gerade auf der Bereitschaft, ĂŒber die eigenen Deutungen hinauszugehen.â (54f.) â Den Ăbergang zum zweiten Hauptteil des Buches bietet folglich ein Abschnitt zu wissenschaftlichem Arbeiten (56-70), das dem Grundgedanken der Legitimationsgebundenheit wissenschaftlichen Wissens sowie dem daraus resultierenden Ethos der Argumentation gewidmet ist.
Dem nachfolgenden Reigen der einheimischen Begriffe ist wohl auch deshalb am deutlichsten der Entstehungszusammenhang des vorliegenden Bandes im Kontext mĂŒndlicher (Rede-) BeitrĂ€ge abzulesen. In den jeweils leitenden Begriff wird zunĂ€chst ĂŒber einen alltagsweltlich bis anekdotisch justierten Einstieg (z.B. die Rezeption von Fake News zur Frage nach der Autonomie von Vernunfturteilen: 71-73; eine Kursinformation ĂŒber die Kunst der Schafschur zur Frage des Lernens: S. 112f;) verwickelt, von wo aus rasch eine ideengeschichtlich prominente bzw. wirkmĂ€chtige (Theorie-)Position oder Streitfrage zur Orientierung im Denken aufgerufen wird und nĂ€here ErlĂ€uterung findet (AufklĂ€rung und die Erziehungsaufgabe nach Kant in Kap. 4; Wurzeln des humanistischen Denkens bei Platon und Cicero mit Blick auf W. v. Humboldt in Kap. 5; Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus im 20. Jh. zum Diskurs um Lernen in Kap. 6; Kompetenz bzw. Kompetenzmodelle nach Weinert, Klieme etc. in Kap. 7 sowie Parsons, Habermas und Mead im Zusammenhang mit Sozialisation, Kap. 8).
Die von groĂer Informationsdichte gekennzeichneten, aber stets eingĂ€ngig formulierten AusfĂŒhrungen werden dann jeweils mit einem kritischen Kontrapunkt zeitgenössisch- erziehungswissenschaftlicher Provenienz abgeschlossen: So wird im Erziehungskapitel der ĂŒberkommene SouverĂ€nitĂ€tsgestus pĂ€dagogischer AutonomieverheiĂungen durch Roland Reichenbachs inkompetenzzentriertes Erziehungsdenken flankiert (86-90), Hans-Christoph Kollers metaphysikkritische Neuakzentuierung von Humboldts Bildungsdenken diesem als Korrektiv zugeeignet (108-111), der erfahrungsvergessene Wissensobjektivismus psychologisch orientierter Lerntheorien durch KĂ€te Meyer-Drawes Fokus auf den fragilen Vollzugscharakter des Lernens relativiert (126-129), unter Rekurs etwa auf einschlĂ€gig rezipierte Arbeiten von Gert Biesta oder Andreas Gelhard auf die Gefahren eines âreduktiven Denkensâ (145) im Gefolge des hegemonialen wie wirksamkeitsbehauptenden Kompetenzdiskurses (142-148) aufmerksam gemacht und auch nicht vergessen, die zwar gelĂ€ufige, aber eben doch auch steril-funktionalistisch anmutende Konturierung des Sozialisationsbegriffes normativitĂ€ts- und gesellschaftskritisch (Habermas, Bourdieu: 155-160 bzw. 165-168) zu weiten.
In gewisser Weise erstreckt sich diese Vorgehensweise (popularisierte Exposition der dem jeweiligen Begriff korrespondierenden Problemlage, exemplarisch-ideengeschichtliche Rahmung, kritische Aktualisierung) auch auf den dritten Teil des Bandes, wobei aber eben (noch) nicht kanonisch gewordene Begriffe oder Begriffsimporte, sondern aktuelle Problemlagen der (zuweilen auch: fĂŒr die) Erziehungswissenschaft skizziert werden, deren Darstellung und Diskussion dann freilich vorwiegend Bezugnahmen auf zeitgenössische AutorInnen und FachvertreterInnen erforderlich macht: Wirksamkeit als Knotenpunkt der PĂ€dagogik (Kap. 9) fĂŒhrt von Rousseaus Emile direkt zu Dietrich Benners praxeologischen BildsamkeitserwĂ€gungen und zur mittlerweile ebenfalls als klassisch zu klassifizierenden Debatte um das Technologiedefizit (Luhmann/Schorr), um schlieĂlich Aufstieg und Kritik einer evidenzbasierten (womöglich aber eher: evidenzorientierten) PĂ€dagogik zu konturieren. In die ebenfalls zu einer Art neuem mainstream kanalisierten Debatten um Ungleichheit, Differenz und AlteritĂ€t (Kap. 10) fĂŒhrt Thompson entlang bildungsbiographisch wie bildungssoziologisch nachgezeichneter UngleichheitsphĂ€nomene (sozusagen PISA Ă rebours: 192-196) ein, Migration, InterkulturalitĂ€t, IntersektionalitĂ€t (Frank-Olaf Radtke, Paul Mecheril, Katharina Walgenbach), HeterogenitĂ€t und Differenz (Hans-Christoph Koller, Kerstin Rabenstein, Sabine Reh: 200-205) sowie AlteritĂ€t (Michael Wimmer, Jan Masschelein, Alfred SchĂ€fer, Kerstin Jergus: 205-208) werden als brisante Herausforderungen wie gleichwohl zentrale Deutungsmuster fĂŒr die erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzung der Gegenwart positioniert. Die mit einer popkulturell durchwirkten Freude an der Sensation in gewisser Hinsicht anhebende â aber am Cyborg-Thema auch nicht eben sonderlich neu entzĂŒndete â Frage nach dem Verbleib des Menschen (Kap. 11) erinnert an die Grundlagen und -linien anthropologischer Bestimmungsversuche und historischer Kritik der conditio humana (Arnold Gehlen, Theodor Ballauff) und prĂ€sentiert schlieĂlich trans- bis post-humanistische DenkeinsĂ€tze im Gefolge der diversen Manifeste Donna Haraways und der rezenten Debatten um das AnthropozĂ€n (Bruno Latour, Olaf Sanders). Thompsons AusfĂŒhrungen hierzu hinterlassen aber den Eindruck einer pĂ€dagogischen Diskussionslage, die, zwischen glasperlenspielerischer AbgeklĂ€rtheit, pathosgesĂ€ttigtem Fatalismus und neo-naivem wishful thinking schwankend, sich noch nicht so recht klar zu sein scheint ĂŒber die GrenzverlĂ€ufe der beanspruchten pĂ€dagogischen ZustĂ€ndigkeit angesichts einer in ihrer kolportierten TotalitĂ€t doch recht einschĂŒchternden und zur NormativitĂ€t nach dem offenbar zu lange schon befeierten Zusammenbruch der Narrative und Standpunkte geradezu Anlass gebenden (Dauer-)Krisensituation â auch schon vor Sars-CoV-2.
Im RĂŒckblick auf die erstaunlich umfangreiche und hochgradig differenziert aufbereitete Erkundungstour Christiane Thompsons wirkt dann aber das noch (eilig?) beigestellte Nachwort (230-232) sonderbar verloren, das etwas gar gedrĂ€ngt versucht, anhand der (wiederum nicht unumstrittenen) Schriften Achille Mbembes auch (post-)koloniale Perspektiven noch aufzugreifen und die davon inspirierte Analyse und Kritik von allerlei âherrschaftsförmigen Wissens- und Denkordnungenâ (231) recht voraussetzungs- und umstandslos zum Aufgabengebiet der an ihnen nicht zuletzt komplizenhaft beteiligten Erziehungswissenschaft zu erklĂ€ren. Mit einigem Vor-, Mit- und Nachdenken wird dieser Forderung wohl auch argumentativ unzweifelhaft Nachdruck verliehen werden können, ein lediglich appendixhafter Appell allein mag zwar auf die Sympathien der entsprechend sensibilisierten LeserInnenschaft zielen, zur Entfaltung von Ăberzeugungskraft wĂ€ren aber gerade in einem EinfĂŒhrungsband doch noch einige Seiten mehr dienlich gewesen, so aber haftet diesem Einsatz leider die Anmutung einer programmatisch-zweifelhaften Diskursmode an.
Aus einer zielgruppenspezifischen Lesart kann nach erfolgtem Durchgang wohl festgehalten werden, dass Christiane Thompsons Zugang gerade aufgrund des Verzichts auf so hĂ€ufig angestrebte enzyklopĂ€disch-ideengeschichtliche Geschlossenheit besondere systematische Kraft entfaltet. Dieser stellt (Erziehungs-)Wissenschaft tatsĂ€chlich als problematisierenden Einsatz im Wissen abseits rezeptwissenschaftlicher Einhegungsversprechen vor, der sich um KontinuitĂ€tsbedenken wie auch um AktualitĂ€tsbezĂŒge auch nach dem vieldiagnostizierten Niedergang der AEW keine Sorgen macht, sich vielleicht auch gar nicht zu machen braucht.
Thompsons AusfĂŒhrungen sind â durchaus auch aus aufmerksamkeitsökonomischer Sicht â hinreichend knapp und niederschwellig lesefreundlich genug, um im workload-orientierten universitĂ€ren Lehrbetrieb rege Verwendung finden zu können, aber auch ausreichend argumentations- und anmerkungsdurchdrungen, um gegenstandsangemessen in den Wissens- und Themeninventar der Disziplin auf der Höhe des aktuellen Rezeptions- und Diskussionsgeschehens herangefĂŒhrt zu werden: Das macht Thompsons Buch fraglos zu einem Ă€uĂerst empfehlenswerten Tipp fĂŒr StudieneinsteigerInnen, auch wenn â der notwendigen Begrenzung geschuldet â die eine oder andere Inkonsistenz Anlass zu RĂŒckfragen bietet, z.B., wenn eingangs zwar neben dem ĂŒblich-paradigmatischen Thomas Kuhn auch Ludwik Flecks Denkkollektiv als VorlĂ€ufer endlich zu seinem Recht kommt (30-32), andererseits aber â und ebenfalls von geradezu selbstverstĂ€ndlicher Ăblichkeit â der diskutierte Falsifikationismus Popperâscher PrĂ€gung (28-30) nicht auch durch den Hinweis etwa auf das VorlĂ€uferkonzept des Fallibilismus nach Charles Sanders Peirce eine lĂ€ngst fĂ€llige wissenschaftshistorische Kontextualisierung erfĂ€hrt. Das aber sind NebenschauplĂ€tze.
Denn mindestens ebenso empfehlenswert ist Thompsons EinfĂŒhrung auch aus einer weniger unmittelbar zielgruppenorientierten Lesart â nĂ€mlich jener der disziplinĂ€ren SelbstverstĂ€ndigung. Aus dieser Sicht wirft die LektĂŒre des Bandes doch auch einige fĂŒr die scientific community selbst möglicherweise bedenkens- und diskutierenswerte Fragen auf:
Wenn Christiane Thompson nĂ€mlich der Allgemeinen Erziehungswissenschaft im Einklang mit Norbert Ricken [2] eine ausdrĂŒckliche ââVermittlungs- und Diskursfunktionââ (14) im Hinblick auf ââKooperation, Moderation und Diskussionââ (ebd.) zuschreibt, im Zuge derer es darum gehe, âdie bestehenden Auseinandersetzungen und Differenzen, die durch unterschiedliche wissenschaftliche Herangehensweisen entstehen, zu sichten, zu ĂŒberprĂŒfen und miteinander ins GesprĂ€ch zu bringenâ (13, auch 17, 70), dann bleibt bei dem gleichermaĂen bekrĂ€ftigten Regulativ des Widerstreits (54) und der Kritik hegemonialer Wissensformen und Denkschemata (230f.) doch fragwĂŒrdig, weshalb als Aufgabe der AEW ausgerechnet die Diskursdiplomatie bestimmt wird und wem gegenĂŒber genau diese Aufgabe eigentlich wie vertreten werden soll. Zum Vergleich: So konnte z.B. (der auch bei Thompson hĂ€ufig zitierte) Hans Christoph-Koller vor wenigen Jahren an prominenter Stelle den âPlatz einer Allgemeinen Erziehungswissenschaftâ [3] noch verstehen âals Ort der Austragung von Konflikten zwischen den verschiedenen pĂ€dagogischen Wissensformenâ (ebd.), prĂ€ziser noch: âDas Allgemeine der Allgemeinen Erziehungswissenschaft bestĂŒnde dann paradoxerweise darin, ein Bewusstsein fĂŒr die Grenzen ihrer unterschiedlichen Wissensformen und Diskursarten zu schaffen, um so den Widerstreit zwischen ihnen offen zu halten oder â wo es erforderlich ist â ĂŒberhaupt erst zur Geltung zu bringen.â (ebd.) â Bei Thompson aber bleibt (mit ihrem Rekurs auf Ricken) die möglicherweise konflikttrĂ€chtige (weil kritikable) Anerkennung von Differenz und HeterogenitĂ€t im Wissen nunmehr ohne Not zugunsten einer frag- wie bodenlos konstruktiveren Vermittlungsleistung der AEW ausgeblendet: Sollte sich so zwischenzeitlich eine weitere unmerkliche Verschiebung des (binnen-)disziplinĂ€ren SelbstverstĂ€ndnisses der AEW Bahn brechen, welche das stets lĂ€stige Kleingedruckte der GeltungsansprĂŒche und Autorisierungsweisen heterogener Wissensformen geflissentlich um der VerstĂ€ndigung willen aus den wissenschaftlichen Debatten wenn schon nicht hinausgeheimnissen soll, so doch fĂŒglich hinauszumoderieren hat? â Wie dem auch immer sei: Kritik aber ist bekanntlich keine diplomatische Kategorie.
Entlang jener Passagen des Buches wiederum, die insbesondere zeitgenössische Konturierungen oder Aktualisierungen von erziehungswissenschaftlichen Begriffs- und ProblembestĂ€nden vornehmen, bricht unweigerlich die Frage nach Genese und Geltung von KanonisierungsbemĂŒhungen auf: Wenn EinfĂŒhrungsliteratur gelesen wird als Antwortversuch auf die Frage nach dem disziplinĂ€re IdentitĂ€t auch konstituierenden RezeptionszusammenhĂ€ngen, dann lĂ€sst sich Thompsons Buch trefflich wohl lesen als EinfĂŒhrung in die zeitgenössische deutsche Allgemeine Erziehungswissenschaft; kann doch, gemessen an den von ihr jeweils aufgerufenen zeitgenössischen Autorinnen und Autoren zuverlĂ€ssig der in den entsprechenden Sektionen bzw. Kommissionen der DGfE langjĂ€hrig prominent tĂ€tige, rezipierte oder in jĂŒngerer Zeit aufstrebende Kreis von ErziehungswissenschaftlerInnen (d.h. LehrstuhlinhaberInnen) ausgemacht werden. Dies erinnert daran, dass Autorisierung (und folglich Rezeption) von Wissen nicht zuletzt immer auch an die Frage seiner Institutionalisierung geknĂŒpft ist; eine Einsicht, die wohl nicht nur fĂŒr Erstsemestrige von Bedeutsamkeit bleibt, die vielleicht ĂŒber die Frage stolpern, wie es denn kommt, dass eben diese (und immer wieder diese) AutorInnen zur LektĂŒre vorgeschlagen werden und nicht etwa andereâŠ
Was schlieĂlich aufgrund der augenfĂ€llig leider nur als billigst zu bezeichnenden und verlagsseitig zu verantwortenden Ausstattung und ProduktionsqualitĂ€t (durchscheinendes Papier, mangelhafte Folierung und Klebung der ohnehin reichlich dĂŒnnen Broschur, sparsamst kalkulierter Satzspiegel, grobkörnige Wiedergabe der Illustrationen, etc.) des vorliegenden Reihenbandes noch anzumerken bleibt, ist eine realisierte Preisgestaltung, die hinsichtlich der ohnehin erwartbar profitablen Absatz- bzw. und Auflagenzahlen bei EinfĂŒhrungswerken in seiner Gewagtheit nicht nur an das berĂŒhmte Verlegerdiktum Arno Schmidts gemahnt, sondern auch die Debatte um die Ăkonomisierung der Lehre und der Lehrmittel durchaus um einen weiteren Akzent zu bereichern vermag: Lesenswerte BĂŒcher dĂŒrfen, wenn man schon die HĂŒrden der Drucklegung auf sich nimmt, doch auch qualitativ gut produzierte BĂŒcher sein?
Das Fazit also (in jeder Hinsicht): AusdrĂŒckliche Mehrfachexemplarbestellungsempfehlung fĂŒr Bibliotheken.
[1] Ruhloff, Jörg (2006): Warum Erziehungswissenschaft als Disziplin? In: Ders./Bellmann, Johannes u.a. (Hrsg.) (2006): Perspektiven Allgemeiner PÀdagogik. Dietrich Benner zum 65. Geburtstag. Weinheim/Basel: Beltz, S. 33-44.
[2] Ricken, Norbert (2010): Allgemeine PÀdagogik. In: Kaiser, Astrid/Schmetz, Dietmar/Wachtel, Peter/Werner, Birgit (Hrsg.) (2010): Bildung und Erziehung. EnzyklopÀdisches Handbuch der BehindertenpÀdagogik, Bd. 3. Stuttgart: Kohlhammer, S. 15-42.
[3] Koller, Hans-Christoph (2006): Das Mögliche identifizieren? Zum VerhĂ€ltnis von Bildungstheorie und Bildungsforschung am Beispiel der erziehungswissenschaftlichen Biographieforschung. In: Pongratz, Ludwig/Wimmer, Michael/Nieke, Wolfgang (Hrsg.) (2006): Bildungsphilosophie und Bildungsforschung. â Bielefeld: Janus, S. 108-123, hier 123.
