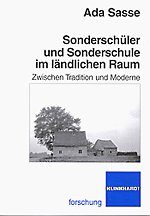 βÄûDie Zentralisierung der Sonderschulen trΟΛgt dazu bei, Ungleichheit bezΟΦglich der Lebensbedingungen von SonderschΟΦlerinnen und SonderschΟΦlern herzustellen beziehungsweise zu verstΟΛrken.βÄ€ So kΟΕnnte man die Grundthese von βÄûSonderschΟΦler und Sonderschulen um lΟΛndlichen RaumβÄ€ formulieren. Ada Sasse interessiert sich fΟΦr die Lebenssituation von SchΟΦlerinnen und SchΟΦlern mit Behinderung aus dem lΟΛndlichen Raum. Diese Lebenssituation sieht sie bisher als βÄûDesiderat empirischer Forschung und konzeptioneller EntwΟΦrfe neuer Organisationsformen sonderpΟΛdagogischer FΟΕrderungβÄ€ (7), was staunen mach, da ein nicht geringer Teil der SchΟΦlerinnen und SchΟΦler aus eben diesem lΟΛndlichen Raum stammt. Den Befund, dass Sonderschulen zwar flΟΛchendeckend erreichbar wΟΛren, damit aber nicht von einer gleichmΟΛΟüigen Streuung sonderpΟΛdagogischer Kompetenz in der FlΟΛche ausgegangen werden kann, fΟΦhrt sie auf eine latente GroΟüstadtorientierung der SonderpΟΛdagogik zurΟΦck, aus der informatorische Defizite in Bezug auf die Lebenssituation in lΟΛndlichen Gebieten entstehen. So kommt es zu einem PhΟΛnomen, welches als βÄûSystemeffekt von SchulenβÄ€ (8) beschrieben werden kΟΕnne, dessen Einzugsbereich den der Regelschulen deutlich ΟΦbersteigt. Deshalb plΟΛdiert Sasse fΟΦr einen Perspektivenwechsel von einer angebotsorientierten zu einer nutzerorientierten Perspektive, um die SchΟΦlerbedΟΦrfnisse (wieder oder ΟΦberhaupt) in den Blick nehmen zu kΟΕnnen.
βÄûDie Zentralisierung der Sonderschulen trΟΛgt dazu bei, Ungleichheit bezΟΦglich der Lebensbedingungen von SonderschΟΦlerinnen und SonderschΟΦlern herzustellen beziehungsweise zu verstΟΛrken.βÄ€ So kΟΕnnte man die Grundthese von βÄûSonderschΟΦler und Sonderschulen um lΟΛndlichen RaumβÄ€ formulieren. Ada Sasse interessiert sich fΟΦr die Lebenssituation von SchΟΦlerinnen und SchΟΦlern mit Behinderung aus dem lΟΛndlichen Raum. Diese Lebenssituation sieht sie bisher als βÄûDesiderat empirischer Forschung und konzeptioneller EntwΟΦrfe neuer Organisationsformen sonderpΟΛdagogischer FΟΕrderungβÄ€ (7), was staunen mach, da ein nicht geringer Teil der SchΟΦlerinnen und SchΟΦler aus eben diesem lΟΛndlichen Raum stammt. Den Befund, dass Sonderschulen zwar flΟΛchendeckend erreichbar wΟΛren, damit aber nicht von einer gleichmΟΛΟüigen Streuung sonderpΟΛdagogischer Kompetenz in der FlΟΛche ausgegangen werden kann, fΟΦhrt sie auf eine latente GroΟüstadtorientierung der SonderpΟΛdagogik zurΟΦck, aus der informatorische Defizite in Bezug auf die Lebenssituation in lΟΛndlichen Gebieten entstehen. So kommt es zu einem PhΟΛnomen, welches als βÄûSystemeffekt von SchulenβÄ€ (8) beschrieben werden kΟΕnne, dessen Einzugsbereich den der Regelschulen deutlich ΟΦbersteigt. Deshalb plΟΛdiert Sasse fΟΦr einen Perspektivenwechsel von einer angebotsorientierten zu einer nutzerorientierten Perspektive, um die SchΟΦlerbedΟΦrfnisse (wieder oder ΟΦberhaupt) in den Blick nehmen zu kΟΕnnen.
Die Gliederung der Dissertation ist stringent: Nach einer KlΟΛrung des Konzeptes βÄûlΟΛndlicher RaumβÄ€ (Kapitel II) und einer kurzen Darstellung der Raumkonzepte in der PΟΛdagogik (Kapitel III), wird der mΟΕgliche Zusammenhang zwischen Professionalisierung und Zentralisierung sonderpΟΛdagogischer Angebote untersucht. DafΟΦr werden historische Ansiedlungsmuster eben dieser Angebote rekonstruiert (Kapitel IV). Im nΟΛchsten Schritt wird die derzeitige Situation in Bezug auf rΟΛumliche Ansiedlung sonderpΟΛdagogischer Institutionen analysiert und zwar folgerichtig anhand des lΟΛndlichsten Bundeslandes, nΟΛmlich Mecklenburg-Vorpommern (Kapitel V). Beide Analysen βÄ™ historische wie moderne Ansiedlung βÄ™ differenzieren nach angebots- und nutzerorientierter Perspektive. Das letzte Kapitel beschreibt die aus der Untersuchung gewonnenen MΟΕglichkeiten zu einem Perspektivenwechsel hin zu einer nutzerorientierten Betrachtung und diskutiert die entsprechenden Neuorientierungen (Kapitel VI).
Die nutzerorientierte Perspektive wird somit der konsequente Ausgangspunkt der sowohl theoretisch wie empirisch gehaltvollen Untersuchung, wobei der methodische Hauptaspekt auf der empirischen Seite zu finden ist. Neben raumordnerischen und agrarsoziologischen AnsΟΛtzen nimmt das BourdieuβÄôsche Kapitalkonzept als theoretische Basisorientierung eine herausragende Stellung ein. Die zentrale Fragestellung, der Ada Sasse nachgeht, ist, inwiefern SonderschΟΦlerinnen und SonderschΟΦler aus dem lΟΛndlichen Raum durch Schule in die Lage versetzt werden, kulturelles und soziales Kapital zu akkumulieren und welche Rolle die Entfernung zwischen Wohnort und Schulort dabei spielt. Kulturelles Kapital wird im Kontext der Studie verstanden als das Erlangen eines formalen Bildungsabschlusses, der das Individuum befΟΛhigt, spΟΛter ΟΕkonomisches Kapital zu akquirieren. Das Ergebnis der Untersuchung ist, dass weite Schulwege oder notwendige Unterbringungen in Internaten einen negativen Einfluss auf die MΟΕglichkeiten der Kapitalakkumulation haben. Dieser negative Einfluss ergibt sich vor allem aus der Separierung der Lebenswelten und der zunehmend seltenen PrΟΛsenz im angestammten Lebensumfeld.
Die Studie ist nicht primΟΛr ein weiterer Beitrag zur Debatte ΟΦber SchulschlieΟüungen und -fusionen. Sie kann vielmehr als der gelungene Versuch verstanden werden, eine bisher kaum wahrgenommene Problemstellung im erziehungswissenschaftlichen Diskurs zu bearbeiten. Denn die Schlussfolgerungen, die aus der stringenten Argumentation folgen, sind bedeutungsvoll: will man sich, so die Autorin, auf eine nutzerorientierte Perspektive einlassen und so die MΟΕglichkeiten schaffen, kulturelles und soziales Kapital bei SchΟΦlerinnen und SchΟΦlern mit Behinderung zu vergrΟΕΟüern, wird man an einer integrationspΟΛdagogischen Orientierung nicht vorbei kommen. Anders formuliert: will man vermeiden, dass sich SchΟΦlerinnen und SchΟΦler, die in Sonderschulen unterrichtet werden, zunehmend von ihrem eigentlichen Lebensumfeld entfremden (und damit fΟΦr die Akkumulation kulturellen Kapitals auf ungleich mehr soziales Kapital verzichten mΟΦssen als jene, die im nΟΛheren Umfeld der entsprechenden Schule wohnen), dann ist es notwendig, sonderpΟΛdagogische Kompetenz in den lΟΛndlichen Raum hineinzubringen und nicht sonderpΟΛdagogische BedΟΦrfnisse aus dem lΟΛndlichen Raum in die StΟΛdte zu transportieren. Ein solches Unterfangen kann nur im Kontext integrativer Beschulung gelingen, fΟΦr den die infrastrukturellen Bedingungen geschaffen werden mΟΦssen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Studie eine bisher kaum wahrgenommene Problemstellung aufdeckt und bearbeitet. Der bewusst interdisziplinΟΛr gewΟΛhlte Ansatz, der soziologische, raumplanerische und pΟΛdagogische Forschungsergebnisse vereint, erscheint als Mittel der Wahl, um sich der Problemstellung anzunΟΛhern und es gelingt, neue Erkenntnisse aus dem sowohl theoretisch wie empirisch interessanten Material zu generieren. Die vorgeschlagenen Neuorientierungen verbleiben dennoch eher moderat: integrative Beschulung als Antwort auf die Problemstellung, resultierend aus einer nutzerorientierten Perspektive βÄ™ dieser Vorschlag enthΟΛlt mehr Potential, zumal die Autorin mit einem Ausblick endet, der auf grΟΕΟüere Problemfelder schlieΟüen lΟΛsst: wenn in den nΟΛchsten Jahren die SchΟΦlerzahlen weiter sinken, der demographische Wandel sich also weiterer Lebensbereiche bemΟΛchtigt, dann ist es fraglich, ob nicht eine βÄûSchule fΟΦr AlleβÄ€ auf der Agenda stehen sollte. Zumindest wΟΦrden die Ergebnisse der Studie einen solchen Schluss ebenfalls zulassen.
