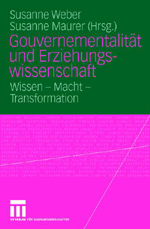 Susanne Weber und Susanne Maurer prĂ€sentieren unter Mitwirkung von insgesamt 18 AutorInnen mit dem vorliegenden Sammelband einen breit gefĂ€cherten Beleg fĂŒr eine zusehends intensiver werdende Rezeption Michel Foucaults (nicht nur) in der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft. Die Herausgeberinnen intendieren, den von Foucault erst spĂ€t entwickelten Ansatz der GouvernementalitĂ€t als Perspektive fĂŒr die Erziehungswissenschaft zu eröffnen â und ihr damit gleichzeitig ein Instrument zur Thematisierung aktueller sozio-politischer Transformationen zu erschlieĂen.
Susanne Weber und Susanne Maurer prĂ€sentieren unter Mitwirkung von insgesamt 18 AutorInnen mit dem vorliegenden Sammelband einen breit gefĂ€cherten Beleg fĂŒr eine zusehends intensiver werdende Rezeption Michel Foucaults (nicht nur) in der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft. Die Herausgeberinnen intendieren, den von Foucault erst spĂ€t entwickelten Ansatz der GouvernementalitĂ€t als Perspektive fĂŒr die Erziehungswissenschaft zu eröffnen â und ihr damit gleichzeitig ein Instrument zur Thematisierung aktueller sozio-politischer Transformationen zu erschlieĂen.
Die âinnovative Kraft des Begriffsâ âGouvernementalitĂ©â liege in seiner âScharnierfunktionâ, die Politik und Wissen einander nicht gegenĂŒberstellt, sondern âein politisches Wissen artikuliertâ, indem âauf das den Praktiken immanente Wissen, die Systematisierung und âRationalisierungâ einer Pragmatik der FĂŒhrungâ rekurriert werde und damit die âVerbindungen zwischen Regierungspraktiken, Normalisierung und Subjektivierungâ als Ausdrucksformen von MachtverhĂ€ltnissen freigelegt wĂŒrden (9ff.). Die alten Dichotomien von Freiheit und Zwang oder Konsens und Gewalt werden durch einen reflexiven Begriff von Regierung, mit Foucault gefasst als âFĂŒhrung der FĂŒhrungenâ ersetzt, âum die spezifischen RationalitĂ€ten der [historischen oder aktuell wirkmĂ€chtigen Weisen von, Anm. RK] Regierung zu identifizierenâ (11), zu analysieren â und zu kritisieren.
Die BeitrĂ€ge des Bandes gruppieren sich entsprechend der Foucaultâschen Kernbegriffe methodisch angelegter Analysen um die vier Achsen RationalitĂ€ten und Typen des Regierens, Strategien des Regierens, Praktiken des Regierens und des Sich-Nicht-Regieren-Lassens sowie Subjektkonstitutionen und Subjektivierungen. Der Band ist gleichermaĂen fĂŒr EinsteigerInnen wie fĂŒr SpezialistInnen interessant: Die umfangreichen Literaturverweise erschlieĂen ebenso leicht den Zugang zur mittlerweile schwer ĂŒberschaubaren Foucault-Rezeption wie sie auch den Bezug zu aktuellen erziehungswissenschaftlichen Fragen bzw. Diskussionen aufrufen.
Die Gliederungsachsen des Sammelbandes zeugen jedoch nicht von dem Versuch, eine starre Architektonik im Sinne einer erziehungswissenschaftlichen Elementarlehre gouvernementaler Perspektiven einzuziehen. Durch den ĂŒbergreifenden Anspruch der Herausgeberinnen, einer StĂ€rkung des Potenzials von erziehungswissenschaftlicher Kritik zuzuarbeiten, bilden sie vielmehr ein bewegliches Koordinatensystem, in dem aktuelle gesellschaftliche Transformationen gemÀà unterschiedlicher Breiten- und Tiefendimensionen in den Blick kommen können. Maurer und Weber fragen in ihrem Eröffnungsbeitrag Die Kunst, nicht dermaĂen regiert zu werden nach Möglichkeiten der Kritik gegenwĂ€rtiger gesellschaftlicher VerhĂ€ltnisse und Entwicklungen. Der GouvernementalitĂ€tsansatz diene sowohl zur Aufdeckung der potentiellen Machtvergessenheit der Erziehungswissenschaft selbst als auch der kritischen Thematisierung der gegenwĂ€rtig hegemonialen Diskursformation des Neoliberalismus: ja, die Denkungsart oder Haltung der Kritik figuriere als GegenstĂŒck zu den verschiedenen Arten des Regierens: âKritik als Kunst der ,reflektierten UnfĂŒgsamkeitâ und der ,freiwilligen Unknechtschaftâ in den Spielen der Wahrheitspolitiken hat also die Funktion der Entunterwerfung (âŠ). Sie knĂŒpft an das VerstĂ€ndnis der AufklĂ€rung an, die gegen UnmĂŒndigkeit, einen Mangel an Entschlossenheit und Mut antrittâ (13). Dies jedoch nicht mehr im Sinne einer emphatischen Richterposition ĂŒber Wahrheit und Ideologie, sondern als (reflexive) Strategie der Ermöglichung von Verschiebungen âim beweglichen Feld der Auseinandersetzungen und diskursiven KĂ€mpfeâ (15). Mit dem vorliegenden Band dokumentieren sie das Anliegen, âdas polyphone Ensemble der Kritik zur Sprache zu bringenâ (17). Die erkenntnisleitende Bestimmung des GouvernementalitĂ€tsansatzes im Sinne einer Unterscheidung von Analyse und Kritik wird dabei durch eine verstĂ€rkt performative Lesart suspendiert.
Den ersten Abschnitt des Bandes, der sich den unterschiedlichen RationalitĂ€ten und Typen des Regierens widmet, eröffnet Michael Peters, der unter RĂŒckgriff auf Foucaults Arbeiten zur Entstehung der Biopolitik die RationalitĂ€t neoliberalen Regierens als Regierung durch den Markt in gegenwĂ€rtigen wissensbasierten Ăkonomien konturiert und â wie ĂŒbrigens alle englischsprachigen BeitrĂ€ge in diesem Band â besonders deutliche wie drĂ€ngende Worte findet, um die sozial(politisch)en Herausforderungen angesichts neoliberaler Ordnungen darzustellen: âIn an age of consumerism, a fundamental question is to what extent, if at all, the âcitizen-consumerâ â a market-democracy hybrid of the subject â can shape privately funded public services in ways other than through their acts of consumption and whether acts of consumption can genuinely enhance the social dimensions of the market (âŠ)â (47). Unter Bezug auf Peters nutzt Robert Doherty die GouvernementalitĂ€tsperspektive fĂŒr eine Kritik an bildungspolitischen Programmatiken unter der Ăgide eines neoliberalen KapitalismusverstĂ€ndnisses, das er nach Peters als âglobale groĂe ErzĂ€hlung" am Beginn des 21. Jahrhunderts begreift (58). Als dessen korrespondierende RationalitĂ€t des Regierens identifiziert Doherty das Konzept der âPolicyâ, âit becomes the theatre par excellence from which to view the living, breathing, evolving drama of governmentâs understanding of governingâ (56) â als Aktivierungsstrategie nicht zuletzt auch in der Bildungspolitik.
Fabian Kessl nimmt Soziale Arbeit als (eine Art der) Regierung in den Blick, nachdem er eine mögliche EngfĂŒhrung in der Interpretation von GouvernementalitĂ€tsstudien im Sinne machttheoretischer Rekonstruktionen um die Ebene machtanalytischer Sichtweisen erweitert, worin âMacht als produktives Element verstandenâ (68) wird: âMacht wird damit nicht (mehr) als substantielles GegenĂŒber von UnterdrĂŒckung oder Ohnmacht gefasst, wie es machttheoretische Annahmen (noch) unterstellen. [âŠ] Nicht ein ,Jenseits der Machtâ kann das Ziel sozialpĂ€dagogischer Interventionen darstellen, sondern Verschiebungen im Diesseits der MachtverhĂ€ltnisse, der historisch-spezifischen Regierungsweisen des Sozialenâ (68ff.). Susanne Webers genealogische Untersuchung zu partizipativen pĂ€dagogischen Lernarrangements und der ihnen zugrunde liegenden RationalitĂ€t des Demokratie-Dispositivs schlieĂt den ersten Themenbereich ab.
Die Strategien des Regierens nimmt der zweite Abschnitt des Bandes in den Blick. Neoliberalismus light vermutet Agnieszka Dzierzbicka angesichts des programmatischen Entwurfes der EuropĂ€ischen Union fĂŒr bildungspolitische MaĂnahmen und untersucht die âLissabon-Strategieâ als Paradebeispiel fĂŒr die Kunst des Regierens in wissensbasierten WirtschaftsrĂ€umen. Sie kommt nach einem prĂ€zisen Durchgang durch die Entwicklung der unterschiedlichen GouvernementalitĂ€ten des Liberalismus (regulierte Ăkonomie als bestimmende Vernunft) aus dem Geist der Staatsraison (Politik als bestimmende Vernunft) und des Neoliberalismus (Markt als bestimmende Vernunft, nach Foucault Ausdruck fĂŒr die Krise des Regierens) zu dem Ergebnis, dass sich die EU hinsichtlich ihrer bildungspolitischen Programmatik wohl einem globalisierten (wie gleichzeitig urbanisierten) Wettbewerb verschreibt, einer umfassenden Deregulierung aber mit dem Bekenntnis zu steuernden und gestaltenden Eingriffen eine Absage erteilt: âJedenfalls lĂ€sst sich feststellen, dass in jenem Jahr, in dem Bologna, Lissabon und ,PISAâ im bildungspolitischen Diskurs fest verankert wurden, Europa die Suche nach einer europĂ€ischen IdentitĂ€t einlĂ€uteteâ (117).
Kontrolliert autonom bildet nach Andrea Liesner die paradoxale Chiffre fĂŒr die in Umsetzung begriffene Architektur des EuropĂ€ischen Hochschulraumes, der sie attestiert: âDass die Hochschulen in vielerlei Hinsicht verbesserungswĂŒrdig sind, wird heute auch institutionsintern kaum bestritten. (âŠ) Die kalkulierende Denkungsart jedoch, zu der Hochschulangehörige als lokale MitgestalterInnen des EuropĂ€ischen Hochschulraumes und als kĂŒnftige BĂŒrgerInnen des ,wissensbasierten Wirtschaftsraumsâ Europa animiert werden, erscheint vor allem deshalb problematisch, weil sie ein verkĂŒrztes VerstĂ€ndnis dessen, was als ökonomisch gilt, mit einem universalen Geltungsanspruch prĂ€sentiertâ (129). Die homogenisierende und vermeintlich universalisierende Freisetzung, Modularisierung und erhöhte DisponibilitĂ€t von (disziplinĂ€ren) WissensbestĂ€nden und -strukturen gemÀà einer auf Dauer gestellten Anpassungsleistung an die Markt- und Wettbewerbslogik habe zu Folge, dass âWissen nur noch im Hinblick auf seine FunktionalitĂ€t interessant [ist], nicht mehr aber in Bezug auf seine systematische und historische LegitimitĂ€tâ (131) berĂŒcksichtigt werde.
Ein zweiter Beitrag Susanne Webers thematisiert pĂ€dagogisches MachtWissen in den Formen des Regierens anhand der Organisationsentwicklung und Frauenförderung bzw. an der Verhandlung der beiden Subjektpositionen âIntrapreneurâ und âMutterâ â und zeigt damit machtanalytische Bruchlinien auf, die die Grenzen disziplinĂ€r-pĂ€dagogischer und neoliberal-ökonomischer RationalitĂ€t verschwimmen lassen: âIn der pĂ€dagogischen Rede des ,Förderns und Entwickelnsâ werden Subjekt und Organisation als ,educational organizationâ zum pĂ€dagogischen Subjekt und pĂ€dagogischen Ort der Steigerung der LeistungsfĂ€higkeit [âŠ] [D]er Intrapreneur und das Kind sind die Humanressourcen, die es zu ,fördern und zu entwickelnâ gilt [âŠ] und zwar im Modus der Ermöglichung, Aktivierung und Optimierungâ (157).
Eberhard Raithelhuber identifiziert in seinem Beitrag Netzwerke âals ein zentrales Element der neoliberalen Programmgestaltungâ und als âeine Art und Weise des Regierens, die darauf zielt, das Verhalten von Individuen und Organisationen zu steuern und diese dazu zu befĂ€higen, sich selbst in politisches Regieren einzubindenâ (163f.). Netzwerke dienen, so Raithelhuber, als Instrumente der KapazitĂ€tssteigerung einer Regierung, die â besonders in gemischter Form von öffentlichen und privaten AkteurInnen â in Bereichen mit erhöhtem Innovationsbedarf zur Lösung gesellschaftlicher Probleme Einsatz finden. Die darin enthaltenen Macht- und HerrschaftsverhĂ€ltnisse lieĂen sich beleuchten, wenn die zur Netzwerkbildung und Funktion erforderlichen Regierungstechnologien â âTechnologien der Agency und der Performanzâ (175, Stichwort: Vereinbarungskultur) untersucht wĂŒrden. Sie alle dienen dazu, potentielle AkteurInnen ganz im Sinne des zuvor bei Weber prĂ€sentierten Modus des Aktivierens und Ermöglichens zur Partizipation an politischen Entscheidungsprozessen zu bewegen: âPolitisches Regieren nimmt damit nicht ab oder löst sich auf, sondern ,rutschtâ unter das hinunter, was bisher als ,politischâ definiert wurdeâ (176).
Die aufgeworfene Ausformung von Regierung in der neoliberalen GouvernementalitĂ€t als zunehmender Selbst-Regierung wird von Tina Besley zu Beginn des Abschnittes ĂŒber die Praktiken des Regierens am Beispiel der neuseelĂ€ndischen Professionaliserungsstrategien bezĂŒglich School Counselling â namentlich anhand der Entwicklung von spezialisierten und zertifizierten Beratungsorganisationen wie der New Zealand Association of Counsellors (NZAC) â weiterverfolgt. Die Wahl zwischen beruflicher Marginalisierung oder erhöhtem Professionalisierungsdruck fĂ€llt nach ihrem (entwaffnend-entunterwerfenden) ResĂŒmee nicht leicht: âIf one assumes that counsellors are generally on the political left, supporting issues of social justice, it may seem somewhat incongruous that they would embrace the sort of training and membership criteria that characterize right-wing, neoliberal values and economicsâ (194).
Wenn gegenwĂ€rtig von Beratung und Professionalisierung die Rede ist, ist auch der Begriff der Evaluation nicht mehr weit. So widmet sich Thomas Höhne der Evaluation als Mittel der Exklusion und zeichnet die Entwicklung des Evaluationsdiskurses vom Taylorismus, dem Scientific Management und dem Fordismus der 1920er und 1930er Jahre ĂŒber den Sputnik-Schock und die dadurch initiierte Weiterbildungsexpansion bis zu seiner Etablierung mit der gesellschaftlichen Durchsetzung der neoliberalen Programmatiken in der Gegenwart nach. Höhne weist im evaluationsimmanenten Anspruch auf Wirkungs- und Leistungskontrolle, also âdie gezielte Einflussnahme auf die SelbststeuerungsfĂ€higkeiten der Subjekteâ (208), ein Indiz fĂŒr ein Machtregime auf, das wohl nicht lĂ€nger hierarchische SteuerungsverhĂ€ltnisse unterstellt, demgegenĂŒber aber â und nicht weniger wirkungsvoll â ein âreflexives, heterarchischesâ (209) etabliert. Die Wirksamkeit dieses Regimes exemplifizieren anschlieĂend Hermann Forneck und Julia Franz am Beispiel des drohenden Verschwindens des (erwachsenenbildnerischen) Weiterbildungskonzepts durch den ökonomischen QualitĂ€tssicherungsdiskurs, der Subjekte ausschlieĂlich als Subjekte des Marktes konstituiert. Eine willkommene Reflexion potentieller Widerstandspraktiken hingegen vollzieht Susanne Maurer abschlieĂend in ihrem Beitrag GouvernementalitĂ€t ,von unten herâ denken, in dem sie Soziale Arbeit und Soziale Bewegungen (insbesondere die Frauenbewegung) als kollektive Akteure beweglicher Ordnungen begreift, die, gestĂŒtzt auf Geschichte, Erfahrung und GedĂ€chtnis der Konflikte und der daraus resultierten âSensibilitĂ€t fĂŒr Machtgeschehenâ (244), möglicherweise je lokalen Widerstand und diskursive Alternativen zur dominanten Art des Regierens bereithalten könnten.
Der vierte und letzte Abschnitt widmet sich den Subjektkonstitutionen und Subjektivierungen, wie sie mit dem pĂ€dagogischen MachtWissen selbst einhergehen. Thomas Coelen richtet in seinem Beitrag den gouvernementalen Blick auf die pĂ€dagogisch-disziplinĂ€re Binnenperspektive und unterstreicht anhand der letzten Texte Foucaults nicht nur dessen erziehungswissenschaftliche Relevanz, sondern skizziert anhand seiner Analyse des Meister-SchĂŒler-VerhĂ€ltnisses in der griechisch-römischen Antike âden Ausblick auf ein (wenn auch nicht macht-, wohl aber) herrschaftsfreies pĂ€dagogisches Miteinanderâ (262). Thomas Hollerbach zeigt mit dem historischen RĂŒckgriff auf die GouvernementalitĂ€t der ErtĂŒchtigung nach Turnvater Jahn, dass Menschenregierungsprogramme weder unfehlbar ânoch in sich vollkommen geschlossen, vielmehr potentiell ambivalent und widersprĂŒchlichâ (266) verfasst sind und â aus dem geduldigen Blickwinkel der Geschichte â nicht selten der Ironie ihrer ErfĂŒllung ausgeliefert werden.
Ein originelles StĂŒck zeitgenössischer Diskursanalyse, die Karl Kraus und seiner Sprachkritik zur Ehre gereicht, tragen Antje Langer, Marion Ott und Daniel Wrana bei, indem sie das entsprechend der Marktlogik zur Ressource geronnene und konstitutiv verknappte Selbst im Wege von Bedarfsermittlung in Stellenanzeigen (als einer gouvernementalen Praxis) untersuchen und feststellen: âIn Bezug auf den Einzelnen wird das Selbst zu einem Kapital, in Bezug auf den Markt aber zu einem knappen Gut; und wie durch jedes knappe Gut entsteht so ein Markt der Selbste, auf dem die Subjekte sich zu positionieren haben, und auf dem sie konkurrierenâ (297). Der abschlieĂende Beitrag des Bandes von Ute Karl befasst sich mit einer gouvernementalen Analyse gerontologischer Alter(n)sdiskurse. Sie weist auf, dass die neoliberale Ăkonomisierung aller Bereiche des Sozialen auch vor dem Alter(n) nicht halt macht, sondern sich in der Rede von erfolgreichem, aktivem und produktivem Alter(n) fortsetzt (304): âDass dabei jeweils nur unterschiedliche Spielarten der Seite des ,gesunden Altersâ thematisiert und die vielfĂ€ltigen und komplexen Lebenslagen des Alters ignoriert werden, ist das eine; ethisch weitaus problematischer ist die damit verbundene implizite Thematisierung eines passiven, gescheiterten oder unproduktiven, womöglich unnĂŒtzen Alter(n)sâ (316). SpĂ€testens an dieser Stelle tritt deutlich â wenn auch an den Grenzen der Artikulierbarkeit â hervor, welchem Zynismus im Verbund mit der neoliberalen GouvernementalitĂ€t zu begegnen ist.
Die Frage nach der systematischen Bedeutung bzw. nach den Entwicklungsmöglichkeiten und auch nach den Grenzen einer gouvernementalitĂ€tssensiblen Erziehungswissenschaft â wie sie vielleicht durch den Titel des Bandes nahe gelegt wird â erscheint nach dem Durchgang durch die einzelnen BeitrĂ€ge nur vage beantwortbar zu sein â zu divers(ifizerend) sind dafĂŒr die eingeschlagenen Foucaultschen Interpretationswege, zu vielstimmig das âpolyphone Ensemble der Kritikâ. Vielleicht ist sie aber auch falsch gestellt. Der sozio-politische Kontext, dessen zahlreiche und unterschiedliche Facetten durch die EinzelbeitrĂ€ge jeweils beleuchtet werden, gibt eher Grund zu der Annahme, dass (kritisch-reflektierende) Erziehungswissenschaft gut beraten wĂ€re, GouvernementalitĂ€t nicht als potentielles neues Paradigma zur Selbstbeschreibung heranzuziehen, sondern ihre Perspektive als wirksames Instrument zur Beschreibung und Analyse vorfindlicher sozialer, also auch disziplinĂ€rer (Macht-)VerhĂ€ltnisse heranzuziehen. In einem vielleicht auf dauerhafte VorlĂ€ufigkeit gestellten zweiten Schritt ermöglicht diese Perspektive die Wahrung, Verteidigung und Durchsetzung kritischer AnsprĂŒche, die ebenso Transformationen unterworfen sind wie ihr Gegenstandsbereich selbst. Was den Rezeptionsstand Foucaults in der Erziehungswissenschaft betrifft, so kann vor dem Hintergrund von GouvernementalitĂ€t und Erziehungswissenschaft jedenfalls festgehalten werden: Noch in den 80er und frĂŒhen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts kam die Bezugnahme auf Foucault und seinen genealogisch-diskursanalytischen Studien zum MachtWissen eher einer Gratwanderung zwischen avantgardistischem Nonkonformismus einerseits â der den Blick ĂŒber den Tellerrand reiner, also von Aspekten der Macht und Herrschaft gelöster Epistemologie ermöglichte â und diversen partiellen Eingemeindungsversuchen andererseits, die hauptsĂ€chlich die historische Bedeutung seiner Arbeiten in den gesellschaftlich normierenden und damit PĂ€dagogik-affinen Bereichen SexualitĂ€t, Psychiatrie, Schule oder GefĂ€ngnis hervorhoben, gleich. Heute scheint Foucault endgĂŒltig im Stadium groĂer diskursiver Aufmerksamkeit angelangt zu sein â und dies nicht zum Nachteil fĂŒr die Erziehungswissenschaft.
