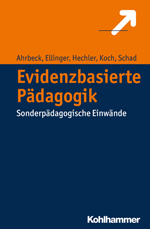 WĂ€hrend im internationalen Fachdiskurs und vor allem im angloamerikanischen Raum die Idee einer evidenzbasierten Praxis bereits seit lĂ€ngerem die Forschungsdebatten dominiert, ist das Thema im deutschsprachigen Raum vergleichsweise spĂ€t und dabei zugleich merklich unkritisch aufgegriffen worden. Der bis dato einzige Versuch einer umfassenden kritischen Reflexion aus erziehungswissenschaftlicher Sicht von Johannes Bellmann und Thomas MĂŒller stammt aus dem Jahr 2011 [1].
WĂ€hrend im internationalen Fachdiskurs und vor allem im angloamerikanischen Raum die Idee einer evidenzbasierten Praxis bereits seit lĂ€ngerem die Forschungsdebatten dominiert, ist das Thema im deutschsprachigen Raum vergleichsweise spĂ€t und dabei zugleich merklich unkritisch aufgegriffen worden. Der bis dato einzige Versuch einer umfassenden kritischen Reflexion aus erziehungswissenschaftlicher Sicht von Johannes Bellmann und Thomas MĂŒller stammt aus dem Jahr 2011 [1].
Gerade in der SonderpĂ€dagogik nimmt die fĂŒr die Disziplin konstitutive Frage nach der Wirksamkeit spezieller FördermaĂnahmen seit jeher einen prominenten Stellenwert in der Diskussion ein, wobei mittlerweile auch hier der Evidenzbegriff Einzug gehalten hat [2]. Trotz einiger kritischer Stimmen fehlt es allerdings bis dato an einer systematischen fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung im Kontext der Sonder- und InklusionspĂ€dagogik. In diese LĂŒcke stöĂt also das vorliegende Werk vor, das eine Kritik an der evidenzbasierten PĂ€dagogik aus sonderpĂ€dagogischer Sicht formulieren möchte. In der Einleitung wird angekĂŒndigt, die Angemessenheit des evidenzbasierten Paradigmas fĂŒr die Theorie und Praxis der Erziehung zu hinterfragen und einen âpĂ€dagogisch begrĂŒndeten Gegenentwurf zu formulieren. Gewagt wird somit die Wiederaneignung der Sache der PĂ€dagogik durch die PĂ€dagogik selbstâ (7). â Dieses Anliegen, soviel kann vorweggenommen werden, gelingt mit dem vorliegenden Werk sehr ĂŒberzeugend.
Der Band enthĂ€lt insgesamt fĂŒnf BeitrĂ€ge, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven kritisch mit der Frage der Evidenzbasierung in der PĂ€dagogik auseinandersetzen. Dabei nehmen die ersten beiden BeitrĂ€ge mit gut 80 Seiten einen erheblichen Raum ein und umfassen mehr als die HĂ€lfte des vorliegenden Werkes.
Im ersten Beitrag bietet Katja Koch einen profunden Ăberblick zur thematischen EinfĂŒhrung. Die Autorin skizziert das Programm einer evidenzbasierten PĂ€dagogik und die zunehmende Adaption von evidenzbasierter Forschung und Praxis in der akademischen SonderpĂ€dagogik. Allerdings sei festzustellen, dass sich aus dem sonderpĂ€dagogischen Fachdiskurs kein âkonsistentes oder gar eigenstĂ€ndiges sonderpĂ€dagogisches VerstĂ€ndnis von Evidenzâ (23) ableiten lieĂe. Insbesondere die die zunehmende Verflechtung der Politik wird kritisch in den Blick genommen und die Folgen fĂŒr das VerhĂ€ltnis von Forschung und Praxis der SonderpĂ€dagogik kritisch hinterfragt.
Im Mittelpunkt des Beitrags von Oliver Hechler steht die theoretische Entwicklung und BegrĂŒndung der pĂ€dagogischen Profession. Die Ăberlegungen reflektieren kritisch das naturwissenschaftlich orientierte VerstĂ€ndnis von Empirie und Wissenschaft, das dem evidenzbasierten Ansatz unterliegt. Die erkenntnis- und konstitutionstheoretische Argumentation fĂŒhrt schlieĂlich zu einem Gegenentwurf, der PĂ€dagogik als Erziehungskunst dem evidenzbasierten TechnologieverstĂ€ndnis entgegenstellt.
Bernd Ahrbeck exemplifiziert im dritten Beitrag die Dominanz evidenzbasierter AnsĂ€tze anhand der Therapie bei HyperaktivitĂ€ts- und Aufmerksamkeitsstörungen. Der sich auf evidenzbasierter Wirksamkeitsforschung grĂŒndende multimodale Therapieansatz stelle einen âReparaturgedankenâ (87) in den Vordergrund, der auf eine standardisierte Symptombehandlung fokussiere und dabei âdie pĂ€dagogische KomplexitĂ€t in hohem MaĂe reduziertâ (92). Gleichzeitig erscheint der âAbsolutheitsanspruchâ, mit dem der Ansatz vertreten wird, durchaus fragwĂŒrdig, nicht zuletzt, da das zugrundeliegende Ă€tiologische Modell erhebliche Inkonsistenzen aufweise und auch der empirische Forschungsstand keine Ăberlegenheit des multimodalen Verfahrens zu belegen vermag.
In folgenden Beitrag geht Stephan Ellinger von der Kernthese aus, dass die gegenwĂ€rtige Politik der Inklusion bei gleichzeitig zunehmender Ăkonomisierung der Bildung zur nachteiligen Entwicklungen an den Schulen und Hochschulen fĂŒhre. Der Autor entlarvt eine Reihe der gegenwĂ€rtigen Ideologien, die dem akademischen Betrieb unterliegen und dabei nicht nur weite Bereiche der wissenschaftlichen Forschung dominieren, sondern gerade auch das VerstĂ€ndnis der modernen Lehrerbildung. Die zunehmende Ausrichtung der SonderpĂ€dagogik am evidenzbasierten Paradigma erweise sich dabei geradezu als kontraindiziert, da sie einseitig formale gegenĂŒber inhaltlichen Aspekten betone. Als inhaltliche Bezugspunkte der sonderpĂ€dagogischen Förderung sozial benachteiligter Kinder verweist der Autor auf die âBeziehungsarbeit und emotionale Entwicklungshilfeâ (117). Die damit zugleich implizierte Schulung und Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen seitens der FachkrĂ€fte finde in den LehramtsstudiengĂ€ngen bis dato kaum hinreichende BerĂŒcksichtigung. Als Ziel der modernen Lehrerbildung wird daher die Entwicklung und Reflexion einer pĂ€dagogischen Grundhaltung formuliert. So wird gewissermaĂen ein Gegenmodell entworfen zu einer zunehmend fachwissenschaftlich ausgerichteten Lehrerbildung in der Gegenwart.
Der vorliegende Band schlieĂt ab mit einigen aphoristischen Betrachtungen (âMiniaturenâ, wie sie der Autor selbst nennt), in denen Gerhard Schad die gegenwĂ€rtige Diskussion um Evidenzbasierung von Forschung und Praxis als Ausdruck allgemeiner zeitgenössischer Signaturen der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung betrachtet, wobei sich das Thema der Ăkonomisierung der Gesellschaft wie ein Grundmuster durch den Text zieht und schlieĂlich zu der Erkenntnis fĂŒhrt, dass die evidenzbasierte PĂ€dagogik eine der wesentlichen Fragen nicht beantworten kann, nĂ€mlich jene nach den Inhalten und Zielen von Erziehung und Bildung.
Das Buch liest sich wie ein eindringliches Mahnwort gegen zeitgenössische Fehlentwicklungen, in denen die Ăkonomisierung lĂ€ngst auch das Erziehungs- und Bildungssystem der Gesellschaft durchdrungen hat und die pĂ€dagogische Praxis unter marktwirtschaftlichen Vorzeichen zunehmend deformiert. Ăberzeugend gelingt es, dem gegenwĂ€rtigen Mainstream der SonderpĂ€dagogik eine genuin pĂ€dagogische Argumentation entgegenzusetzen, die auf den Kern der pĂ€dagogischen Sache rĂŒckverweist und diesen gegenĂŒber der zunehmenden Deformation durch Ăkonomisierung und auch gegenĂŒber den Ăbergriffigkeiten anderer Disziplinen sowie simplen technologischen Ableitungen verteidigt. Getragen werden die vorliegenden BeitrĂ€ge durch eine gemeinsame grundlegende Kritik am evidenzbasierten Paradigma, die sich aus der InadĂ€quatheit des Modells fĂŒr die Erziehungs- und Förderpraxis herleitet. Die notwendige KomplexitĂ€tsreduktion, auf die sich die standardisierten und technologischen Methoden einer evidenzbasierten PĂ€dagogik grĂŒnden, kann der ĂberkomplexitĂ€t von Erziehungs- und Bildungsprozessen nicht gerecht werden. Damit geraten zugleich das positivistische WissenschaftsverstĂ€ndnis sowie das zugrundeliegende Menschenbild des evidenzbasierten Paradigmas in die Kritik, das Menschen âmehr oder weniger als triviale Ursache-Wirkungs-Maschine(n)â (6) betrachtet.
Die Kritik am evidenzbasierten Ansatz wird in den EinzelbeitrĂ€gen aus einer klaren pĂ€dagogischen Positionierung heraus formuliert. Dabei wird es allerdings versĂ€umt, das evidenzbasierte Paradigma vor dem Hintergrund des inklusiven Erziehungs- und Bildungsauftrags zu reflektieren. Die entscheidende Frage, inwieweit evidenzbasierte FördermaĂnahmen tatsĂ€chlich als inklusive FördermaĂnahmen zu betrachten sind [3], wird nicht vertieft, obschon aus kritischer Betrachtung genau hieran erhebliche Zweifel angemeldet werden können [4]. Hier wĂ€re es sicherlich auch reizvoll, dem in erster Linie methodologisch argumentierenden evidenzbasierten Forschungsparadigma auch auf der gleichen Argumentationsebene zu begegnen, indem zum Beispiel die konkrete Frage nach der Methodik einer inklusionsorientierten Forschung [5] zu diskutieren wĂ€re.
Das vorliegende Werk ist sehr wichtig und lĂ€ngst ĂŒberfĂ€llig, denn es setzt ein deutliches, wenn auch verspĂ€tetes Signal zur kritischen Reflexion und Selbsthinterfragung gegenwĂ€rtiger Forschungspraktiken. Dabei steht sehr viel mehr auf dem Spiel als der rein akademische Wettbewerb um die Deutungshoheit fĂŒr die ârichtigenâ oder âwirksamstenâ FördermaĂnahmen; es geht zugleich um die Autonomie der Wissenschaft, deren Freiheit in Forschung und Lehre infolge steuerungspolitischer Ăbergriffigkeiten mehr denn gefĂ€hrdet erscheint.
[1] Bellmann, J. / MĂŒller, T. (Hrsg.): Wissen, was wirkt: Kritik evidenzbasierter PĂ€dagogik. Wiesbaden: VS Sozialwissenschaften, 2011.
[2] vgl. exemplarisch: Odom, S. L. / Brantlinger, E. / Gersten, R. / Horner, R. H. / Thompson, B. /Harris, K. R. (2005): Research in Special Education: Scientific Methods and Evidence-Based Practices. In: Exceptional Children 71 (2), 137-148.
Cook, B. G. / Schirmer, B. R. (Eds.): What Is Special about Special Education?: Examining the Role of Evidence-Based Practices. Austin: pro-Ed, 2006.
[3] Huber, C. / Grosche, M.: Das response-to-intervention-Modell als Grundlage fĂŒr einen inklusiven Paradigmenwechsel in der SonderpĂ€dagogik. Zeitschrift fĂŒr HeilpĂ€dagogik, 63 (2012) 8, 312-322.
[4] Ferri, B. A.: Undermining inclusion? A critical reading of response to intervention (RTI). In: International Journal of Inclusive Education, 16 (2012) 8, 863-880.
Rödler, P.: RTI â ein Konzept der Entkulturierung von Lernen. In: Amrhein, B. (Hrsg.), Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 232-242.
[5] Buchner, T. / Koenig, O. / Schuppener, S. (Hrsg.): Inklusive Forschung: Gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten forschen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2016.
