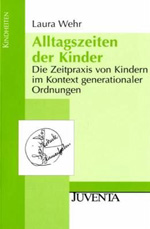 Zeitforscher/innen sprechen seit geraumer Zeit von einer „Beschleunigung“ der Gesellschaft und zugleich von Entgrenzungen und Auflösungen zeitlicher Strukturen und Normen, die auch auf das Alltagsleben von Kindern weitreichende Auswirkungen haben. Wie sich dieser Wandel, der die zunehmende „Verplanung“ als ein zentrales Merkmal heutiger Kindheit hervorruft, aber tatsächlich auf ebendiese auswirkt, ist bisher wenig erforscht. In diesem Forschungsdesiderat siedelt sich die vorliegende kulturwissenschaftliche Studie an, die 2008 als Dissertation an der Universität Basel angenommen wurde. Die Autorin möchte mit ihrer Arbeit ganz bewusst einen Gegenentwurf zu den bisherigen „Diskursen über Kinder liefern, indem sie die alltägliche Zeitpraxis von Kindern aus der Perspektive der Kinder […] dicht beschreibt und analysiert“ (15).
Zeitforscher/innen sprechen seit geraumer Zeit von einer „Beschleunigung“ der Gesellschaft und zugleich von Entgrenzungen und Auflösungen zeitlicher Strukturen und Normen, die auch auf das Alltagsleben von Kindern weitreichende Auswirkungen haben. Wie sich dieser Wandel, der die zunehmende „Verplanung“ als ein zentrales Merkmal heutiger Kindheit hervorruft, aber tatsächlich auf ebendiese auswirkt, ist bisher wenig erforscht. In diesem Forschungsdesiderat siedelt sich die vorliegende kulturwissenschaftliche Studie an, die 2008 als Dissertation an der Universität Basel angenommen wurde. Die Autorin möchte mit ihrer Arbeit ganz bewusst einen Gegenentwurf zu den bisherigen „Diskursen über Kinder liefern, indem sie die alltägliche Zeitpraxis von Kindern aus der Perspektive der Kinder […] dicht beschreibt und analysiert“ (15).
Im Zentrum der Untersuchung stehen 21 in einer deutschschweizer Kleinstadt lebende elf- bis dreizehnjährige Jungen und Mädchen einer fünften Klasse. Das umfangreiche Datenmaterial wurde während einer sechsmonatigen Feldforschung (Kreisgespräche, Anfertigen von Zeittagebüchern u.a.) sowie durch Leitfaden-Interviews mit 19 Kindern, acht Müttern und einer Lehrerin gewonnen. Obgleich die Entscheidung, die Auswertung entlang der drei Themenfelder, wie Kinder Zeit wahrnehmen und bewerten (Kap. IV), womit und wie sie ihre Zeit verbringen (Kap. V) und wie sie mit Zeitgrenzen umgehen (Kap. VI) darzustellen, richtig getroffen wurde, wären kurze Fallbeschreibungen der Kinder zur Orientierung hilfreich.
Wer im Lesen von ethnographischen Studien unerfahren ist, muss sich zunächst an die Komposition des Buches gewöhnen, wird dann aber mit anregenden Befunden belohnt, die so manches bestehende (Vor-)Urteil in ein anderes Licht rücken. So findet sich z.B. die kulturpessimistische Rede von der „verplanten Kindheit“ in den Empfindungen der Kinder nicht so recht wieder. Entgegen der Einschätzung vieler Erwachsener fühlen diese sich „nicht durch institutionalisierte Freizeitangebote, sondern vor allem durch die zeitlichen Anforderungen der Schule in ihrer Gestaltungsfreiheit eingeschränkt“, denn die Schulzeit ist für die Schülerinnen und Schüler, offensichtlich trotz Wochenplan und Co., überwiegend „von Routine, Monotonie und Langeweile geprägt“ (239). Ein Ergebnis, dass vor allem Schulpädagogen zum Nachdenken und zu weiterer Forschungsaktivität anregen dürfte.
