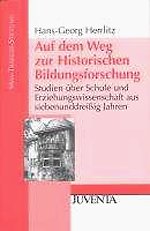 Wanderer kennen das: Auf längeren (Berg-)Touren kommt man immer wieder an Stellen vorbei, die mit einer schönen Aussicht locken und zum Rasten einladen. Der Rundblick über die Landschaft und die bis dahin zurückgelegte Wegstrecke lässt ein Stück Zufriedenheit aufkommen und gibt gleichzeitig Kraft für die noch folgende Wegstrecke. Auch im Leben gibt es immer wieder solche Punkte, an denen wir zurückschauen und Bilanz ziehen. Ein solcher Punkt im Leben eines Wissenschaftlers ist sicher die Emeritierung. Der Göttinger Erziehungswissenschaftler und Bildungshistoriker Hans-Georg Herrlitz hat dies nun zum Anlass genommen, um seine persönliche Forschungsbilanz aus 37 Jahren als Bildungsforscher zu ziehen. Herausgekommen ist dabei unter dem Titel "Auf dem Weg zur Historischen Bildungsforschung" ein ebenso interessanter wie inspirierender Wanderführer durch Herrlitz‘ wissenschaftliche Welt.
Wanderer kennen das: Auf längeren (Berg-)Touren kommt man immer wieder an Stellen vorbei, die mit einer schönen Aussicht locken und zum Rasten einladen. Der Rundblick über die Landschaft und die bis dahin zurückgelegte Wegstrecke lässt ein Stück Zufriedenheit aufkommen und gibt gleichzeitig Kraft für die noch folgende Wegstrecke. Auch im Leben gibt es immer wieder solche Punkte, an denen wir zurückschauen und Bilanz ziehen. Ein solcher Punkt im Leben eines Wissenschaftlers ist sicher die Emeritierung. Der Göttinger Erziehungswissenschaftler und Bildungshistoriker Hans-Georg Herrlitz hat dies nun zum Anlass genommen, um seine persönliche Forschungsbilanz aus 37 Jahren als Bildungsforscher zu ziehen. Herausgekommen ist dabei unter dem Titel "Auf dem Weg zur Historischen Bildungsforschung" ein ebenso interessanter wie inspirierender Wanderführer durch Herrlitz‘ wissenschaftliche Welt.
Eine solche Bilanz ist natürlich immer auch ein Stück Selbstvergewisserung. Aber eben nicht nur. Nach der Lektüre kann man Hans-Georg Herrlitz sofort zustimmen, wenn er meint, dass sich "dem autobiographischen Rückblick auf eigene Arbeiten generelle Einsichten in die Disziplingeschichte abgewinnen lassen" (S. 12). Denn Herrlitz langweilt seine Leser nicht mit einem ausschweifendem autobiographischen Panorama der kleinen Eitelkeiten – auch wenn er dies einleitend als eine Motivation für diese Aufsatzsammlung ein wenig selbstironisch einräumt –, sondern legt mit insgesamt 15 Beiträgen einen diachronen Querschnitt durch sein wissenschaftliches Œuvre der letzten vier Jahrzehnte vor. Er bündelt diese Studien aus der Zeitspanne zwischen 1964 und 2000 unter den thematischen Schwerpunkten "Schule" (8 Beiträge) und "Erziehungswissenschaft" (7 Beiträge) und verdeutlicht damit zwei Zentren seiner Forschungstätigkeit.
Das thematische Spektrum des Schwerpunktes "Schule" erstreckt sich von zwei Beiträgen zur Didaktik des Deutschunterrichts (Johann Gottfried Herders Beitrag zur Didaktik der Schullektüre [1964, S. 19-31], Vom politischen Sinn einer modernen Aufsatzrhetorik [1966, S. 33-53]) über Studien zur Hochschulreife (1968, S. 75-91 und 1971, S. 55-74), Notizen zum Stichwort "Schule – Schultheorie" (1974, S. 107-110), einer politischen "Kampfschrift" aus dem Jahr 1978 zur Stellungnahme des nordrhein-westfälischen Philologen-Verbandes für ein gegliedertes Schulwesen (S. 111-123), die Sozialgeschichte des Gymnasiums (1997, S. 93-105) bis hin zu "Thesen zur Interpretation der deutschen Schulgeschichte" unter dem Titel "Der mühsame Fortschritt der Schulreform" (2000, S. 125-138).
Der zweite Teil "Erziehungswissenschaft" enthält Beiträge zur Geschichte der erziehungswissenschaftlichen Einrichtungen der Universitäten Kiel (1966, S. 141-156) und Göttingen (1987, S. 157-178), entfaltet Materialien zur "Restauration der deutschen Erziehungswissenschaft nach 1945 im Ost-West-Vergleich" (1988, S. 179-197), behandelt "Kontinuität und Wandel der erziehungswissenschaftlichen Lehrgestalt" (1996, S. 199-218), eröffnet einen Blick auf "Einhundert Jahre ‚Die Deutsche Schule‘" (1997, S. 219-235) – das Profil der Zeitschrift, die Herrlitz durch seine Tätigkeit wesentlich mitgeprägt hat –, informiert über "Das Ausland als Argument im erziehungswissenschaftlichen Diskurs 1945-1995" (2000, S. 237-255) und fragt abschließend, ob wir "Aus Geschichte lernen" können (1986, S. 257-267). Die Einleitung zu dieser Aufsatzsammlung (S. 11-16) sowie die Quellennachweise der ursprünglichen Publikationsorte (S. 269-270) rahmen dieses Panorama ein. Nützlich wäre sicher ein die Texte erschließendes Personenregister gewesen.
Wie beim Wandern ist es offenbar auch auf dem Weg der wissenschaftlichen Biographie so, dass der Weg aus ein wenig Distanz heraus betrachtet viel klarer aussieht, als man es auf den verschlungenen Pfaden im Gestrüpp noch glauben mochte. Sicher war sein wissenschaftlicher Weg auch Herrlitz nach der Promotion noch nicht so klar, wie er sich jetzt durch die Aufsatzsammlung darstellt. Auch hierin liegt das Fesselnde dieses Buches, zeichnet sich indirekt doch auch ab, wie sich eine Identität als Wissenschaftler im wissenschaftlichen Diskurs herausbildet. Wie ist nun Herrlitz‘ wissenschaftliche Wanderkarte durch vier Jahrzehnte Disziplingeschichte vermessen? So interessant und inhaltlich facettenreich die einzelnen Beiträge des Bandes auch sind, sie inhaltlich hier im Einzelnen würdigen zu wollen, wäre unsinnig, sind sie doch in anderen Zusammenhängen bereits rezipiert worden. Vielmehr will ich nach der einigenden Klammer suchen und damit die Orientierungspunkte seines wissenschaftlichen Weges kennzeichnen.
Aus den thematisch weit gespannten Beiträgen lassen sich zwei Leitmotive der historisch-pädagogischen Forschungen von Hans-Georg Herrlitz ermitteln: Das erste kann mit einer Formulierung aus dem Beitrag zur Entstehung des Abiturexamens (Studienrecht als Standesprivileg, 1971) verdeutlicht werden: über "historische Grundlagen aufzuklären" (S. 55). Mit einer traditionellen Ideengeschichte lassen sich keine historischen Einsichten gewinnen, höchstens lässt sich so "nur die eine Hälfte der historischen Wahrheit" (S. 97) – ein bei Herrlitz beliebtes Motiv – andeuten. Historische Erkenntnisgewinne stellen sich dagegen erst ein, wenn man, wie er es in seiner Studie über die Göttinger Pädagogik im 19. Jahrhundert (1987) formuliert, "von dem Höhenzug Herbart’scher Systematik" hinabsteigt "in die Wirklichkeit des akademischen Wissenschaftsbetriebes" und sich dabei von "schlichten Fragen" (S. 157) nach den historisch-konkreten Gelehrten, Fakultäten und Disziplinen, nach den Ausbildungszielen, den Ausbildungsinhalten, den institutionellen Rahmenbedingungen, den Studenten und etwa den Lehrveranstaltungen leiten lässt. "Sehen wir also näher zu." (S. 157)
Der genaue Blick auf die historische Wirklichkeit also ist das zentrale Motiv. Damit meint Herrlitz selbstverständlich nicht "einen naiven Empirismus", sondern eine "empirisch und theoretisch gehaltvolle Weiterentwicklung der historischen Schul- und Bildungsforschung" (S. 14-15). Seine historischen Fragen sind dabei alles andere als "schlicht", sie bereiten vielmehr erst die Basis für tragende Interpretationen. Damit fühlt sich Herrlitz der "realistischen Wendung in der pädagogischen Forschung" verpflichtet, wie sie sein Göttinger Amtsvorgänger Heinrich Roth 1962 gefordert hat. Wenn auch die frühen Arbeiten in weiten Zügen noch recht traditionell und deskriptiv sind, so zeigen sie unübersehbar aber schon die Fragen nach dem historisch-konkreten Ort des Untersuchungsgegenstandes. Somit spiegeln die hier versammelten Aufsätze nicht nur Herrlitz‘ eigene Wissenschaftlerbiographie, sondern vor allem den Weg der historischen Bildungsforschung in den letzten drei bis vier Jahrzehnten von der traditionellen, ideengeschichtlich orientierten "Geschichte der Pädagogik" zur empirisch arbeitenden, archiv- und quellenorientierten, an realen historisch-pädagogischen und bildungspolitischen Prozessen interessierten historischen Bildungsforschung. Dementsprechend versteht Herrlitz die Geschichte der Pädagogik als "forschende Disziplin nach dem Muster einer historischen Sozialwissenschaft" (S. 11).
Das zweite Leitmotiv seiner bildungshistorischen Forschungen ist die Frage nach der Demokratisierung der Bildungsbeteiligung und der Beseitigung der Ungleichheit in der Bildungsbeteiligung. In seiner resümierenden Vorlesung zu den "mühsamen Fortschritten der Schulreform" formuliert er eine These, die dieses Anliegen verdeutlicht und gleichzeitig seinen eigenen Forschungsbeitrag verortet: "Sozialgeschichtlich betrachtet ist seit den 60er Jahren an den Schulen und Hochschulen der Bundesrepublik mehr in Bewegung gekommen als in jeder Epoche der deutschen Bildungsgeschichte zuvor. Zwar ist es bislang keineswegs gelungen, die soziale Ungleichheit der Bildungsbeteiligung in ihren vier klassischen Ausprägungen [...] restlos zu beseitigen, doch hat es auf jedem dieser Problemfelder [...] unterschiedlich zufrieden stellende Fortschritte gegeben." (S. 134)
Herrlitz‘ eigene Arbeiten, die hier dazuzurechnen sind, sind insgesamt einem modernisierungstheoretischen Forschungsansatz verpflichtet, "der auf die langfristigen Erfolge der staatlichen Bildungspolitik" (S. 128) verweist. Stets auf der Grundlage empirisch gewonnener, z.T. serieller Daten fragt er u.a. nach Entwicklungstrends, Wachstumsschüben oder historischen Stagnationsphasen. Allerdings: Wie bringt man eine an historischen Subjekten und Einzelfällen orientierte Forschung zusammen mit den Ergebnissen historischer Längsschnitte auf der Basis serieller Daten, ohne dabei die Einzelfälle und die mit ihnen verbundenen Prozesse vernachlässigen, ignorieren oder nivellieren zu müssen und andererseits ohne den Blick auf langfristige Entwicklungsschübe aus den Augen zu verlieren. Eine Antwort auf diese m.E. nicht ganz unwesentliche methodische und forschungsstrategische Frage habe ich auch bei Herrlitz noch nicht gefunden.
Nicht selten sind auch historisch-sozialwissenschaftliche Studien recht trockene Kost für die Leser. Bei Herrlitz nicht. Denn er zeigt, dass Narrativität und Auswertung serieller Daten kein Widerspruch sein muss. Überhaupt sind seine Arbeiten immer erfreulich klar in der Sprache und präzise im Urteil. Auch zeichnet ihn eine für deutsche Professoren meist ungewöhnliche, aber wohltuende Selbstdistanz aus, die er etwa in der Einleitung unter Beweis stellt, wenn er sich selbstkritisch und nicht ohne Ironie mit seinem Sprachgebrauch der 70er Jahre auseinandersetzt, auf seinen frühen "forschen Optimismus" (S. 14) verweist oder schildert, wie er einen "originellen, höchstpersönlichen Einfall" (S. 15) gleichzeitig in einer Arbeit eines Kollegen entdeckte. So entbehrlich manche Leser die Einleitung als Gebrauchsanweisung für die Aufsatzsammlung vielleicht empfinden werden – denn die Beiträge sprechen für sich selbst –, so erfrischend lässt sie sich lesen und so klar zeigt sie Herrlitz‘ persönlichen Stil als Wissenschaftler – und natürlich seinen autobiographischen Blick.
Aus der Verbindung der skizzierten beiden leitenden Forschungsperspektiven erwächst ein bildungspolitisches Engagement, das Herrlitz‘ Arbeiten durchgängig kennzeichnet. Er versteht seine historischen Arbeiten selbstverständlich nicht rein positivistisch oder antiquarisch, sondern verfolgt eine wissenschaftlich-aufklärende Absicht, um aus dem gesellschaftlich verflochtenen historischen Prozess Problemlösungsstrategien abzuleiten. Die Frage nach Zweck und Ziel der historischen Forschung ist stets immanent vorhanden. Er bezieht politisch Stellung, ohne kurzschlüssige historische Analogien zu zeichnen oder Historie politisch zu funktionalisieren. (Wenn das in den 70er Jahren auch bei ihm nicht ganz ausgeschlossen war, so bedauert er dies im Rückblick merklich [S. 15]). Ganz auf dieser Linie befindet sich sein Anliegen, "nicht nur die schul- und bildungshistorische Forschung in hochspezialisierten Projekten weiter voranzutreiben, sondern die Ergebnisse dieser Bemühungen in den Wissensbestand von Hand- und Lehrbüchern zu übersetzen" (S. 15). Dort bündeln sich dann im Idealfall ideen-, struktur- und sozialgeschichtliche Gesichtspunkte als empirisch abgesicherte Grundlage künftiger Bildungsplanungen. Dieses Engagement verdeutlich Herrlitz, wenn er im letzten Beitrag "Aus Geschichte lernen?" (1986) nach dem Ziel historischer Bildungsforschung überhaupt fragt: "Historisch begründet und empirisch fundiert Illusionen auszuräumen und Mutlosigkeit zu zerstreuen – könnte das nicht doch eine überzeugende Antwort auf die Frage von Herwig Blankertz sein, ‚zu welchem Ziel eigentlich‘ eine sozialwissenschaftlich orientierte Schulgeschichte gelesen werden sollte?" (S. 265) Ich meine, ja! Vielleicht hat schon Fontane diesen Gesamtkontext auf den Punkt gebracht: "Corinna, wenn ich nicht Professor wäre, so würd ich am Ende Sozialdemokrat."
Nicht nur wissenschaftlichen Wanderern sei dieses Buch empfohlen, sondern vor allem jenen Lesern, die sich für unsere Disziplingeschichte im Spiegel der Entwicklung einer Wissenschaftlerbiographie interessieren. Gerade Menschen, die zur wissenschaftlichen Wanderschaft aufbrechen wollen, wird dieses Buch eine ermutigende Reiselektüre sein. Dass sich quasi im Vorbeigehen dabei auch so manches Inhaltliches lernen lässt, versteht sich bei den materialreichen Arbeiten von Hans-Georg Herrlitz von selbst. Wenn er für den Titel dieser Aufsatzsammlung die Metapher des Weges wählte, so deutet Herrlitz damit nicht nur den Suchprozess nach dem "richtigen" Weg an, sondern signalisiert auch, dass der Weg noch lange nicht sein Ziel erreicht hat.
